Montag 08.07.2024 – Ausgeraubt
Ringgg! – der Wecker klingelt. Es ist noch stockduster, als ich mich auf den Weg an die Hauptstraße mache. Auf geht’s nach Nigeria! Erst mit einem Sammeltaxi, für die letzten Kilometer dann mit dem Mototaxi, mache ich mich auf den Weg zur Grenze. Nachdem ich wieder bei der ersten Geldwechselstube angekommen bin, sehe ich ein, dass ich mein Wunsch-Wechselkurs hier nicht bekommen werde und wechsle meine CFA-Noten in nigerianische Naira. Neunzig Euro entsprechen umgerechnet etwa 150.000 Naira, wobei die größte Naira-Banknote einen Wert von 1000 Naira (0,57€) hat – Ich bekomme also mehre zentimeterdicke Geldbündel in die Hand gedrückt. Der Grenzübergang verläuft überraschend problemfrei – nach zehn Minuten und ein paar Fragen bekomme ich meinen Einreisestempel. Direkt hinter Grenze steige ich in ein Buschtaxi, dass mich nach Lagos bringen soll. Allerdings bin ich der erste Fahrgast – ich müsste also erstmal warten. Nach eineinhalb Stunden Wartezeit machen wir uns endlich auf den Weg – die Zeit sitzt mir im Nacken: Ich möchte heute noch vor Einbruch der Nacht im über 300 Kilometer entfernten Benin City ankommen. Leider kommen wir alles andere als zügig voran. Grund dafür sind unzählige Polizei- und Militärcheckpoints die auf ersten Kilometern hinter der Grenze die Straßen blockieren – zwanzig Stück zähle ich, nach gerade einmal 30 Kilometern. Während man von mir zwar jedes Mal den Pass sehen will, mir diesen aber freundlich – manchmal noch einen Kommentar zur deutschen Nigerlage gegen Spanien machend – zurückgibt, haben meine Mitreisenden es schwerer. Jedes Mal denken sich die Polizisten einen neues Problem aus, dann müssen alle aussteigen, es wird eine halbe Stunde diskutiert und schlussendlich ein Schmiergeld bezahlt – bei zwanzig Checkpoints summieren sich die teils nicht niedrigen Forderungen der Beamten schnell auf beachtliche Summen. Irgendwann wechseln wir die Strategie: Meine Mitreisenden fahren mit Mototaxis bis hinter den letzten Checkpoint, wo ich und der Fahrer dann wieder zu ihnen stoßen. Die Motoräder werden nämlich kaum kontrolliert und mich winkt man auch im Auto durch. Gegen halb elf – eigentlich hätte ich vor einer Stunde einen Bus nach Benin City nehmen wollen – erreichen wir dann Lagos erste Marginalsiedlungen. Unser Fahrer hält kurz am Straßenrand um seinen Reifen aufpumpen zu lassen, da bekommen wir Polizeibesuch – Er dürfe hier nicht halten, wir müssten alle aussteigen. Einer der Polizisten setzt sich ins Auto und fährt mit diesem Weg, keine zwei Minuten später sind auch die beiden anderen Beamten wieder verschwunden. Von dem Auto – und vor allem meinen Gepäck, dass sich noch in dessen Kofferraum befindet – fehlt jede Spur. Ich bin keine drei Stunden in Nigeria und schon sind – absehen von dem was ich am Mann trage – alle meine Sachen spurlos verschwunden. Laptop, Notfallgeld, meine gesamte Ausrüstung … alles weg! Ich könnte nicht sagen, dass man mich nicht gewarnt hätte – „Häufig werden kriminelle Akte durch „falsche Uniformierte“ verübt, d.h. Kriminelle, die sich als Polizisten oder Soldaten ausgeben“ schreibt das Auswärtige Amt dazu. Während ich mir schon ausmale, wie ich das meinen Eltern beichte und die Botschaft um Hilfe beim Suchen meines Gepäcks bitten muss, lädt unser ziemlich überrumpelte Fahrer die anderen Fahrgäste und mich in ein Tuk-Tuk, dass uns wohl zur Polizeistation bringen soll. Eine riesige Last fällt von meinen Schultern, als wir dort zwischen stillgelegten Fahrzeugen – ein Wunder, dass es sowas hier überhaupt gibt – den roten Volkswagen finden. Reflexgesteuert reiße ich den Kofferraum auf, schnappe mir erleichtert meinen Rucksack und stapfe davon. Um kurz nach stehe ich dann endlich bei „Mile 2“, einem großen Verkehrsknotenpunkt zwei Meilen außerhalb von Lagos. Rund um eine hochmoderne Metrostation fahren von hier Busse in alle Teile des Landes. Lagos ist mit knapp 15 Millionen Einwohnern die größte Metropole auf dem afrikanischen Kontinent. Während man mit dem Auto bis zu sechs Stunden brauchen soll, um von der einen Seite der Stadt auf die andere zu fahren, gibt es ein fortschrittliches Netzwerk aus U-Bahnen und Zügen und Fähren, dass die auf mehre Inseln verteilte Stadt verbindet. Es wäre durchaus interessant etwas mehr von dieser Stadt zu sehen, doch ich beschränke mich auf den Busbahnhof. Begleitet von einer jungen Frau aus dem ersten Buschtaxi, die ebenfalls nach Benin City will, mache ich einen Kleinbus ausfindig und kaufe mir für 12.000 Naira (6,87€) ein Ticket. Bis wir irgendwann von dem Gelände rollen ist es halb drei – Hoffnungen im Hellen anzukommen habe ich keine mehr. Nachdem wir eine weitere halbe Stunde an der Tankstelle vergeudet haben, geht es dann langsam aber sicher in Richtung Benin City. Die Straße ist recht akzeptabel befahrbar, alle paar Kilometer kreuzen wir einen – mal mehr, mal weniger problematischen – Checkpoint. Die Leute im Bus sind freundlich – um die Schmerzen in meinem Gesäß zu übertünchen reicht das allerdings nicht. Nach fünf Stunden Fahrt haben wir uns unserem Ziel auf 100 Kilometer genähert und machen, während die Sonne den Himmel rötlich tüncht, eine kurze Essenspause, bevor es dann im Dunkeln weitergeht. Ich bin absolut fertig, als wir kurz nach zehn Benin City erreichen – ab ins Bett. Nur hat das Hotel in dem ich eigentlich die Nacht verbringen wollte, keine Zimmer mehr frei – nur noch Suites für den doppelten Preis. Ein paar hundert Meter weiter mache ich einen dunklen Bau ausfindig, bei dem ebenfalls ein Schild darauf hinweist, dass es sich um ein Hotel handeln soll. Für 5000 Naira (2,86€) bekomme ich ein Doppelbettzimmer. Luxus bekommt man für den Preis natürlich nicht, erwarte ich aber auch nicht – für eine Nacht wird’s wohl reichen …
Dienstag 09.07.2024 – Pannenfahrt
Benin City war einst die Hauptstadt eines einflussreichen Königreichs. Weltbekannt ist die Stadt unter anderem durch die bei Auktionen für millionenwerte gehandelten Benin Bronzen – jene Kunstwerke, die – bis man vor zwei Jahren ihre Rückgabe beschloss – in Deutschen Museen zu finden waren, haben hier ihren Ursprung. Die Stadt bietet einiges an spannender Geschichte, doch ich mache mich schon in aller Frühe wieder auf die Suche nach einem Bus. An einem kleinen Busterminal finde ich einen Direktbus ins fast 500 Straßenkilometer entfernte Calabar. Die Wartezeit bis zur Abfahrt nutze ich, um mich bei den fliegenden Händlern mit Proviant einzudecken. Obwohl Nigeria ein englischsprachiges Land ist, verstehe ich die Menschen teils schlechter, als wenn sie Französisch reden. Das Englisch wird vor sich hin genuschelt und fleißig mit Akzenten aus der lokaler Stammessprache versehen. Für die Zahlen hat sich auch einfach neue Begriffe ausgedacht – mit britischem oder amerikanischem Englisch hat das Englisch hier wenig zu tun. Was ich beim Shoppen dennoch merke ist, wie günstig Nigeria ist. Gerade bei Produkten westlicher Firmen ist der Preisunterschied zu den letzten Ländern extrem. Eine Rolle Mentos kostet mich nur 300 Naira (0,17€), ein halber Liter Coca-Cola 400 Naira (0,23€). Neben der unglaublichen Inflation des nigerianischen Nairas, tut die Tatsache, dass viele westliche Firmen ihre Produkte für den afrikanischen Markt hier in Nigeria produzieren, ihr Übriges – auf der Sprite-Flasche prangt ein „proudly Nigerian“-Logo. Um neun Uhr rollt unser Bus los. Die Fahrzeit beträgt laut Google Maps achteinhalb Stunden – dass es sich dabei um eine Utopie handelt, ahne ich noch nicht. Die Straßen – wenn man das ganze überhaupt so nennen kann – werden mit jedem Kilometer schlechter. Generell scheint heute alles zusammenzukommen, was eine Fahrt verzögern kann: Staus, in denen wir teilweise eine Stunde stehen, schlecht gelaunte Polizisten an den Checkpoints, die jedes Gepäckstück unter die Lupe nehmen wollen, ein platter Reifen und ein Fahrer, der an jeder Kreuzung in exakt die andere Richtung fährt, als meine Navigationsapp es für sinnvoll hält. Um 15 Uhr kommen wir im 240 Kilometer von Benin City entfernten Enugu an. Leider liegt die Stadt nicht wirklich auf der Route nach Calabar – unserem Ziel haben wir uns in den vergangenen sechs Stunden gerade einmal um 100 Kilometer genähert. Uff! Meine Laune ist im Keller, mein Geduldsfaden wird mächtig auf die Probe gestellt. Immerhin scheint es einen Grund zu geben, warum wir nach Enugu gefahren sind: Wir klauen hier von einem anderen Bus der Firma einen Ersatzreifen – den, den wir dabeihatten, haben wir ja schon im Einsatz. Nach dem – wieder einmal viel zu lange dauernden – Stopp, beginnen wir dann tatsächlich in Richtung Calabar zu fahren. Unsere Route führt uns durchs Nigerdelta. Hier fließt der drittgrößte Strom Afrikas, nachdem er vom Fouta-Djallon-Gebirge in Guinea auf über 4000km Länge ganze fünf Länder durchquert hat, in den Atlantik. Meine Begeisterung für den Fluss hält sich allerdings in Grenzen – mir schwirrt vor allem im Kopf, dass vor Reisen in das Flussdelta besonders gewarnt wird. Die angespannte Sicherheitssituation wird schnell auch auf der Straße sichtbar: Aus den kleinen Polizei-Checkpoints sind hochgesicherte Militärhochburgen geworden. Hinter Schützenwällen aus Sandsäcken verstecken sich bis an die Zähne bewaffnete Soldaten. Anstatt hier und da mal aussteigen zu müssen, müssen alle Passiergiere die Checkpoints nun zu Fuß durchqueren – der Bus darf nur leer hindurch fahren. Eine Separatistengruppe sei hier besonders stark, erklärt mir ein Mitreisender. Ausgerechnet jetzt beginnt es zu schütten, die Straßen werden immer kleiner und nicht zuletzt wird es nun dunkel. „Fahrten nach Einbruch der Dunkelheit sind unbedingt zu vermeiden. Bei unvermeidbaren Nachtfahrten nutzen Sie stets ein gut gesichertes oder noch besser gepanzertes Fahrzeug und eine bewaffnete Eskorte“ erinnere ich mich an die Empfehlung meiner zuständigen Auslandsvertretung, während wir in dem weißen 15-Sitzer Kleinbus langsam weiter rollen. Die letzten Kilometer bis nach Calabar ziehen sich – schlechten Straßen sei Dank – noch einmal ordentlich in die Länge. Es ist schon wieder kurz nach zehn, als wir unser Ziel in Calabar erreichen. Noch so frühes Aufstehen scheint also auch kein Allheilmittel gegen Nachtfahrten zu sein. Erschöpft schleppe ich mich ins Hotel, hole mir noch eine Portion Reis mit Fisch an der nächsten Straßenecke und lasse mich dann in mein Bett fallen.
Mittwoch 10.07.2024 – Festgehalten
Heute mal kein Wecker – stattdessen sind es unzählige juckende Mückenstiche, die ich die Nacht über bekommen habe, die mich am Morgen auf die Beine bringen. Anders als die letzten beiden Tage, muss ich heute keine Kilometer mehr reißen. Mein Tagesziel ist lediglich ein kleiner Hafen auf der anderen Seite des Calabar Rivers, von dem aus ich mich morgen auf den Weg nach Kamerun machen könnte. Zuerst brauche ich dafür aber den Visa-Sticker, der letzte Woche noch so viel Verwirrung gestiftet hatte. Als ich um halb zehn im kamerunischen Konsulat ankomme, herrscht dort schon Hochbetrieb – neben mir sind zwei Australier und ein Asiate dort. Nachdem ich die inoffizielle Bearbeitungsgebühr von 10.000 Naira (5,72€) bezahlt habe, nimmt man sich sofort meiner an und klebt mir den Visa-Sticker in den Pass. Gemeinsam mit dem Australier mache ich mich dann auf den Weg Richtung Hafen. Er und seine Frau sind auf zwei Motorrädern unterwegs, die sie auf einer größeren wöchentlich fahrenden Fähre nach Kamerun verschiffen lassen wollen. Der Grund warum so viele – für Afrika-Verhältnisse – Reisende über den Seeweg nach Kamerun einreisen ist, dass die Landgrenzen seit vielen Jahren geschlossen sind. Zwischen den beiden Ländern gibt es immer wieder Spannungen, das Grenzgebiet ist infolge dessen Speerzone. Die einzige Möglichkeit die Grenze auf dem Landweg zu passieren, besteht an einer kleinen Grenze ganz im Norden. Der 100 Kilometer quer durch die nigerianischen Highlands führende Offroad-Pfad mit mehren Flussdurchfahren, scheint – zumindest gemessen an der Anzahl der Diskussionen darüber – die Offroad-Herausforderung Afrikas schlechthin zu sein. Hat man allerdings keinen Geländewagen mit Allrandantrieb und Differentialsperren, reist mit öffentlichen Verkehrsmittel oder hat einfach keine Lust sich Meter für Meter durch den Schlamm zu kämpfen, dann bleibt einem nur der See- oder der Luftweg. In dem kleinen Fährterminal am Hafen, treffe ich auf einen marokkanischen Fahrradfahrer, der ebenfalls nach Kamerun möchte. Pünktlich um zwölf steigen wir auf die Fähre die uns an den richtigen Ort dafür bringen soll. Eine Stunde entspannte Schiffsfahrt später landen wir in Oron an. Von hier fahren kleine Motorboote nach Kamerun. Am Hafen erfahren wir das heute schon alle Boote weg wären. Während ich bereits damit gerechnet hatte, hat der Marokkaner nun ein Problem – sein Nigeria Visum endet heute. Als er in der kleinen Polizeistation am Hafen um Rat fragt, werden die Nachrichten nicht besser – sein Nigeria Visum läuft nicht heute aus, sondern ist bereits vier Tage überzogen. 2000 US-Dollar koste jeder überzogene Tag, kann man die nicht zahlen … der Polizist deutet pantomimisch einen Knast an. Da ich dem Marokkaner leider auch nicht helfen kann, mache ich mich nach einiger Zeit aus dem Staub, buche mir ein Zimmer in einem Hotel und bespreche schonmal meine morgige Überfahrt mit einem Bootsbesitzer, den mir die Polizisten ans Herz gelegt hatten. Den restlichen Tag über genieße ich die Ruhe: Die Menschen in Oron sind freundlich, ein kleiner authentischer Markt ziert die Straßen rund um den Hafen. Grundsätzlich habe ich mich in Nigeria nicht unsicherer gefühlt, als in den anderen Länder zuvor. Die Menschen sind genauso freundlich, sprechen – mehr oder weniger verständliches – Englisch, die Preise sind ein Traum. Hätte man sich die Reise- und Sicherheitshinweise zu Nigeria vorher nicht durchgelesen, so wäre einem diesbezüglich wahrscheinlich nur die extreme Polizeipräsenz- und Korruption aufgefallen. Ich kann durchaus verstehen warum Menschen sich entscheiden durch dieses Land nicht in drei Tagen durch zu hasten, sondern auch hier etwas Zeit verbringen. In erster Linie ist es ein mediengemachtes Image, dass Nigeria den „hochgefährlich“-Stempel verleiht. Auch für große Teile Kameruns klingen sie Sicherheitshinweise alles andere als berauschend – nur hat „Africa In Miniature“ irgendwie einen besseren Ruf abbekommen. Am Abend taucht der Marokkaner in meinem Hotel auf. Sein Pass sei immer noch in der Polizeistation – die einzige Lösung sei vermutlich Geld, wieviel wisse er noch nicht. Aber er sei zuversichtlich, dass er morgen mir nach Kamerun käme …
Donnerstag 11.07.2024 – Kurz vorm Absaufen
Wie gestern abgesprochen, holt mich der Bootsbesitzer am Morgen im Hotel ab und bringt mich zum Hafen. Ohne Probleme bekomme ich meinen Ausreisestempel und bin dann bereit für die Fahrt. Anders siehts es bei Marokkaner aus: Die Polizisten lassen ihn wohl doch tiefer in die Tasche greifen, als er es gehofft hatte – seine letzten Naira-Reserven sind allerdings beschränkt. Obwohl ich meine letzten Naira auch noch dazulege, reicht das Geld am Ende nur um ihn freizukaufen, nicht aber, um die 30.000 Naira (17,17€) teure Überfahrt nach Kamerun zu bezahlen. Irgendwie finden wir auch dafür eine Lösung – er würde in Kamerun Geld abheben und das dann dem Boot wieder mitgeben. Eine weitere Stunde lang stehen wir am Hafen und warten darauf, dass die kleinen Motorboote fertig beladen und betankt sind. Um halb elf legt dann – nach drei Stunden Wartezeit – das erste Boot mit dem Marokkaner und seinem Fahrrad ab. Mich hat man aus irgendwelchen scheinheiligen Gründen auf ein anderes Boot verfrachtet, bei dem erstmal noch das Starterkabel ausgetauscht werden muss. Es steigen noch zwei weitere Fahrgäste, beides Kameruner, hinzu und dann holt man auch unseren Anker endlich ein. Immer am Ufer entlang stoppen wir bei einem nigerianischen Kontrollboot nach dem nächsten. Insgesamt sieben mal werden unsere Dokumente kontrolliert, jedes Mal selbstverständlich ein paar Scheinchen ausgetauscht – das läuft auf dem Wasser nicht anders als auf der Straße. Beim letzten Boot macht man mir Probleme – man könne mich hier nicht ausreisen lassen, das Risiko Opfer von Piraterie zu werden sei mit einem Weißen an Bord zu hoch. In diesem Fall geht es dem Beamten nicht um meine Sicherheit, sondern nur um einen Vorwand für zusätzliches Schmiergeld, aber tatsächlich ist der Golf von Guinea bekannt dafür, dass immer wieder Schiffe inklusive ihrer gesamten Mannschaft verschwinden. Kaum haben wir das letzte Kontrollboot hinter uns gelassen, beginnt es wie aus Eimern zu schütten. Bei unseren durchschnittlichen 70km/h Geschwindigkeit fühlen sich die Regentropfen eher wie Eishagel an. Je weiter wir uns vom Ufer entfernen, desto rauer wird die See. Zwei Stunden harre ich, mich an dem großen Sack, auf dem ich sitze festkrallend, einfach nur aus. Mein Klamotten sind inzwischen – trotz Regenjacke – bis auf die Unterwäsche durchnässt, ich will mir gar nicht ausmalen, wie es um die Dokumente, die ich in meiner Hosentasche habe, steht. Durch den Wind und die nassen Klamotten ist es eiskalt – ich warte einfach nur, dass diese Bootsfahrt irgendwann vorbei ist – drei Stunden soll die dauern. Gerade als ich auf meinem Handy sehe, dass es gar nicht mehr weit bis in unserem Zielhafen ist, nimmt der Regen noch einmal zu, die Wellen werden größer. Wasser schwappt in besorgniserregenden Mengen in unser kleines restlos überladenes Motorboot. Der Fahrer stoppt den Motor, ich glaube in seinen Panik erkennen zu können, hilflos beginnt er mit einem aufgeschnittenen Kanister Wasser aus dem Boot zu schippen, während die doppelte Menge auf der anderen Seite wieder hineinschwappt. Einer meiner Mitfahrer weint und auch ich habe ehrliche Angst – wir sind gerade kurz davor Abzusaufen. Zwei weitere Boote eilen uns zur Hilfe. Man befiehlt mir in ein wesentlich leereres Boot umzusteigen, kaum bin ich im „sicheren“ Boot denke ich an meinen Rucksack – den brauch ich auch noch. Allerdings ist die Lücke zwischen den beiden Booten inzwischen wieder mehrere Meter breit – wir fahren ohne mein Gepäck weiter. Ich zähle einfach nur die Minuten herunter bis wir uns irgendwie durch die Wellen zum Hafen gekämpft haben. Währenddessen spielen sich in meinem Kopf alle Worst-Case Szenarios durch: An Land schwimmen? Würde ich schaffen. Was wenn das Boot mit meinem Rucksack nicht ankommt? Es kann doch nicht sein, dass ich zum zweiten Mal in 72 Stunden mein gesamtes Gepäck verliere. „Thank God!“ ruft mein Sitznachbar, als unser Boot bei strömenden Regen den kleinen Hafen in Idenau erreichen – recht hat er. Zu meiner Freude ist auch das Boot mit meinem Rucksack drauf angekommen. Unter dem Dach des kleinen aus Wellblech gebauten Immigration-Büros atme ich erst einmal tief durch, freue mich auf festem Boden zu stehen und lege dann den Beamten meinen vollständig durchweichten Reisepass vor. Hilfe bekomm ich von dem Kameruner, der mit mir auf dem Boot war. Unter dem Vorwand, dass er dann ein direktes Taxi buchen könnte, überzeugt er mich, nicht wie geplant nach Limbe zu fahren, sondern mit ihm nach Douala zu kommen. Ich könne bei ihm schlafen, mich frisch machen, mich sortieren. Mir kommt das ganz gelegen, denn ich habe nicht einen einzigen Franc Bargeld. Gerade als wir los wollen taucht auch der marokkanische Fahrradfahrer auf. Sein Boot hatte als der Regen einsetzte in einem anderen Hafen in Nigeria Halt gemacht und war erst jetzt angekommen. Auch ihn lädt der Kameruner ein mitzukommen und so steigen wir zu dritt in ein Sammeltaxi Richtung Douala. Erst im Dunkeln erreichen wir die Ausläufer von Kameruns größter Metropole. Schnell stellt sich heraus, dass der Kameruner gar keinen Platz zuhause für uns hat, stattdessen plant er uns ein Hotel zu buchen. Nachdem wir etwas gegessen haben, bucht er uns also in zwei edlen Hotelzimmern ein. Endlich kann ich meine tropfnassen Sachen ausziehen. Als ich mein ebenfalls nicht vom Wasser verschontes Netzteil in die Steckdose stecke, knistert es kurz und knallt dann – okay, das lädt wohl nichts mehr auf. Meine Powerbank blinkt nur wild vor sich hin, mein Handy zeigt eine Warnung an – es befände sich Wasser im Ladeanschluss. Egal, das muss bis morgen warten – ich brauche jetzt erstmal dringend Schlaf.
Freitag 12.07.2024 – An- und klarkommen in Kamerun
Als ich am nächsten Morgen aufwache, sieht die Welt schon wieder ein bisschen heiler aus. Die Powerbank funktioniert wieder, mein Handy lädt ohne Fehlermeldung – nur das Netzteil scheint die Bootstour nicht überlebt zu haben. Mein Impfpass, dessen Seiten ich gestern noch einzeln zum Trocknen ausgelegt hatte, kann ich nun wieder zusammentapen. Die Stempel in meinem Pass sind verwaschen – irgendwie schade, gleichzeitig zeigt das aber auch: Dieser Pass hat was erlebt … das passiert eben, wenn man Dinge viel benutzt. Eigentlich wollte unser edler Gönner von gestern heute morgen zum Hotel kommen, doch auch eine halbe Stunde nach der Zeit, die er uns gesagt hatte, fehlt von ihm jede Spur. Der Marokkaner und ich beschließen also dennoch auszuchecken, denn ohne Bargeld und Internet sind unsere Handlungsmöglichkeiten sehr begrenzt … und irgendwann würden wir gerne auch frühstücken. Wir machen uns also auf den Weg zum nächsten Geldautomaten. Obwohl auch in Kamerun der CFA-Franc verwendet wird, handelt es sich dabei nicht um die gleiche Währung wie in den westafrikanischen Ländern. Zwar haben westafrikanische und zentralafrikanische CFA den exakt gleichen Wechselkurs und Namen, doch sind es andere Banknoten und Münzen. Mit Bargeld ausgestattet gehen wir als erstes zum SIM-Karten-Anbieter und kaufen uns SIM-Karten – ohne Internet geht nichts. Nach einem Brunch müssen wir uns dann auf die Suche nach einem günstigen Hotel machen. Die Zimmer in denen wir die letzte nach verbracht haben kosten 10.000 Franc (15,25€), laut Onlinerecherche dürfte es allerdings schwierig werden etwas günstigeres zu finden. Anders als in Nigeria sind Unterkünfte in Kamerun recht teuer. Wir werden dennoch fündig: Direkt hinter einem großen Carrefour-Supermarkt finden wir ein kleines Hotel, dass uns Zimmer für 5000 Franc (7,62€) anbietet – sogar mit funktionierenden WLAN. Das man die Zimmer auch stundenweise buchen kann, sagt denke ich genug darüber aus, was für ein Hotel das ist, aber das stört uns nicht – Hauptsache eine günstiger Bleibe … irgendwas wo ich meine Sachen trocken und mich etwas sortieren könnte. Am Abend stellen wir fest, dass auch das Essen in Kamerun hochpreisiger ist, als es das in den letzten Ländern war. Am Straßenrand mal eben einen Teller Reis mit Soße für 300 Franc (0,46€) Essen? Nicht in Kamerun. Mindestens 500 Franc (0,76€), für die meisten Straßengerichte aber eher 1000 Franc (1,52€) muss man pro Mahlzeit einplanen. Auch das Angebot ist nun anders: Reis findet man kaum noch, Kochbanen – leider nur gebraten und nicht frittiert – bekommt man dafür nun an jeder Ecke.
Samstag 13.07.2024 – Unterwegs im Zentrum Doualas
Zum Frühstück gibt es Nutella-Brot. Okay, kein echtes Nutella, aber immerhin wieder irgendeine lokale Nuss-Nougat-Creme – anders als in Togo und Benin, ist die hier nämlich endlich wieder ansatzweise finanzierbar. Mit einem Sammeltaxi machen wir uns auf den Weg ins Stadtzentrum Doualas. Viel zu bieten hat die Stadt trotz ihrer Größe nicht: Eine kleine Kathedrale und ein ziemlich heruntergekommenes Kunstmuseum. Immerhin essenstechnisch hat die Innenstadt mehr zu bieten, als die Straßen rund um unser Hotel: Nachdem wir zum Mittag Fisch mit Reis und Kochbanane gegessen haben, finden wir in einer Straße sogar einen Stadt der frische Säfte anbietet. Mhh! Fruchttechnisch hat Kamerun ein paar Neuerungen im Angebot: Während meine geliebten Ananas nun wieder teurer sind gibt es Mengen an Litschis und Safou. Die aus Kamerun stammende pflaumenähnliche Safou-Frucht, gibt es gebraten, gekocht und roh an jeder Ecke – ich bleib dann aber lieber bei den Litschis … oder einem frischen Mangosaft. In einem Park treffen wir uns mit einem Freund von dem Marokkaner. Mit seinem Fischerhut kommt der mir irgendwie bekannt vor … den hab ich irgendwo schonmal gesehen … Tatsächlich! Mitte April ging eine Suchmeldung durch sämtliche Facebook-Gruppen – Ein Backpacker wird in Nigeria vermisst. Das auf dem Foto ist er! Auf meine Frage was damals passiert sei, erzählt er mir entspannt das Polizisten an der Grenze zu Niger ihn für einen französischen Journalisten gehalten, ihm sein Handy abgenommen und dann mehre Tage festgehalten hätten. Während wir gemeinsam weiter durch die Stadt laufen, stelle ich fest wie fokussiert der Mann auf seine GoPro und sein Handy ist. Genauso wie sein fahrradfahrender Landsmann macht er YouTube-Videos – während der Fahrradfahrer aber nur hier und da mal kurz die Kamera zückt, sehe ich seinen Freund nicht ein einziges Mal ohne GoPro oder Handy in der Hand. Irgendwie schade! Gerade Nigeria hat mir wieder einmal bewiesen, dass die echten Erlebnisse Off-Kamera passieren. Obwohl ich in den drei Tagen, die ich dort war, unglaublich viel Erlebt und unzählige Eindrücke gesammelt habe – viel mehr als sonst – habe ich in der Zeit keine zehn Fotos gemacht. Dieses ständige draufhalten müssen – es stört mich. Man dokumentiert doch schließlich die Reise und reist nicht, um zu dokumentieren. Ich für meinen Teil, bleibe deshalb beim Schreiben – auch wenn die beiden Marokkaner mir versichern, dass YouTube-Videos machen das Tollste der Welt sei und auch ich unbedingt damit beginnen müsse.
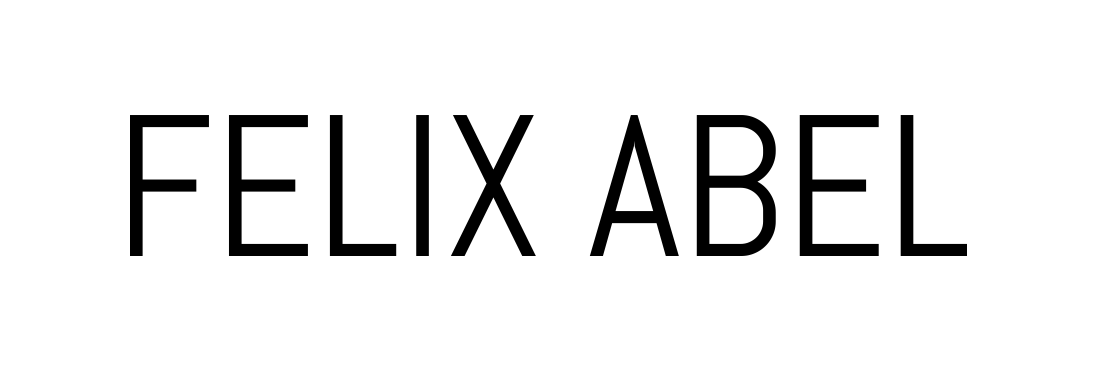





























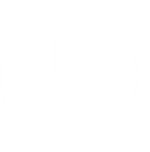


Sonntag 14.07.2024 – Regengedanken
Draußen schüttet es mal wieder – ich bleibe also direkt im Bett liegen und gucke mir den Livestream des Gottesdienstes aus dem ICF in Hamburg an. Der Marokkaner hat gestern Abend nachdem wir zurück im Hotel waren noch Besuch von einem anderen Fahrradreisenden algerischer Herkunft bekommen. Der Algerier erzählt mir, dass er – neben YouTube-Videos – seine Reise damit finanziert, dass er in Tischlereien arbeitet. Für ein paar Euro könne man in jeder Werkstatt arbeiten, dann baut er ein paar Stühle, verkauft die und hat wieder genug Geld für die nächsten Wochen. Im Supermarkt beeindruckt mich wie entspannt der Algerier dennoch mit seinem Geld umgeht. Originales Nutella, Kekse, Süßgetränke, Honig, … alles Dinge, die ich mir die letzten Monate nicht geleistet habe. Über Sparen und Rücklagen scheint er sich wenig Sorgen zu machen. Am frühen Nachmittag steigt der Algerier wieder auf sein Fahrrad, der Marokkaner und ich möchten eigentlich auf den Markt im Stadtzentrum, aber es regnet schon wieder – oder immer noch? Stattdessen verkrieche ich mich also in meinem fensterlosen Zimmer und gucke „The Race“. Bei dem neuen YouTube-Format müssen es fünf Teilnehmer so schnell wie möglich ohne Geld von Marokko zurück nach Köln schaffen. Die Serie catch mich – nicht nur, weil ich die mehr oder weniger selbe Strecke – halt genau andersherum – auch schon ohne Geld bestritten habe, sondern auch, weil mich sie mich inspiriert wieder mehr auf Menschen und weniger auf mein Geld zu setzten. Seit ich Amsterdam verlassen habe, war meine Reisekasse nie unter 200€ gefallen. Ich hatte jederzeit ein stabiles Speckpolster – genug Geld um mindestens zwei Wochen ohne Einnahmen weiterreisen zu können. Sicherlich ist das aus verantwortungsvoller und vorsorglicher Perspektive auch gut so! Gleichzeitig reizt mich aber dieses ohne Geld unterwegs sein – der Zwang dazu Menschen und nicht Euronen als Schlüssel zum Glück zu nutzen. Davon, dass ich vor neun Monaten einst ohne einen einzigen Cent gestartet war hatte ich die letzten Monate zugegebener Maßen nämlich ziemlich wenig gemerkt – mal abgesehen davon, dass ich jeden Tag meine Ausgaben in eine Excel-Tabelle eintrage und mir beim kleinsten Abwärtstrend sofort Sorgen mache. Egal ob bei „The Race“, bei dem Algerier oder bei Influencern wie „MovelikeG“ – den Mut zu haben, das Speckpolster wegzulassen, sein Geld – wenn man welches hat – auf den Kopf zu hauen und sich ansonsten auch ohne Geld durchzuschlagen, das hat irgendwie was, das ist wahres Abenteuer. Und – ob das jetzt positiv ist oder nicht – ich bin gerade auf dem besten Wege dahin: Seit zwei Wochen habe ich in Folge der Sommerferien nicht eine einzige Nachhilfestunde gegeben. Zieht man provisorisch schonmal die Kosten für mein letztes Visum auf dem Weg nach Südafrika ab, so steht meine Reisekasse unmittelbar davor in den zweistelligen Bereich zu fallen – der niedrigste Stand seit Amsterdam.