Montag 19.02.2024 – Vergängliche Schönheit
Auch wenn mein Ziel für diese Etappe der südlichste Punkt Afrikas ist, ließ ich es mir nicht nehmen auch den westlichsten Punkt Kontinentalafrikas zu besuchen. Dieser liegt ganz im Westen von Dakar auf einer Landzunge und ist gar nicht mal so leicht zu erreichen wie anfänglich gedacht – Die von Google Maps vorgeschlagene Route endete an einer zugemauerten Straße. Schlussendlich gelang es mir durch einen Spalt zwischen zwei Häusern an den entsprechenden Strand zu kommen. Neben mir erstrecke ich ein Resort – oder besser gesagt, dass was davon übrig war. Der ehemalige Pool – inklusive schwimmender Bar – lag trocken, Gras wucherte aus allen Fugen heraus über die Terrassen, das Hotelgebäude war in Teilen eingestürzt. Bei jedem Schritt schreckte man ganze Schwärme von Vögeln auf, die in den Ruinen ein Zuhause gefunden hatten. Die dystopische Szenerie wäre die perfekte Kulisse für einen Endzeit-Film gewesen. Mein Ziel war allerdings nicht dieser äußerst photogene Lost-Place, sondern ein kleines Holzschild am Ende des Strandes, dass den westlichsten Punkt markiert und die Entfernung zu einigen großen Städten kundgab: Johannesburg – 6714km; Rio de Janeiro – 6145km; Lissabon – 2793km; Paris – 4212km. Von den Schildern blätterte die Farbe ab, einige lagen sogar bereits auf dem Boden. Der Polstab der danebenstehenden Sonnenuhr war abgebrochen, die früher einmal mit Uhrzeiten beschrifteten Steine nun blank. Man konnte eindeutig sehen, dass hier einmal eine Touristenattraktion war, doch deren Zeiten waren – aus welchen Gründen auch immer – nun vorbei. Als ich mich dem halb zerfallenen hölzernen Schiffsbug näherte, der einmal als Selfiepunkt gedient hatte, erhob sich ein Adler von dem Konstrukt. Zurück auf dem Parkplatz, auf dem ich campe, wechselte ich in Badeklamotten und tauchte in den kühlen Atlantik. Bis zu meinen heutigen Nachhilfestunden war es noch ein bisschen hin und so nutzte ich die Gelegenheit um die kleine Insel N’Gor, die – theoretisch sondern in Schwimmentfernung vor dem gleichnamigen Strand liegt. Nach drei Startversuchen des Motors ging es für 1000 Franc (1,53€) mit einem kleinen Holzboot auf die winzige Insel. Neben ein paar netten Strandunterkünften, bildet die ruhige und grüne Insel einen kompletten Kontrast zum restlichen Dakar, hat darüber hinaus aber auch nicht viel zu bieten. Ein weiteres Boot bringt mich zurück aufs Festland, wo ich mich in einem Restaurant niederlasse und Nachhilfe gebe – gleich vier Stunden hatte ich mir heute hintereinander gelegt. Während der Akku meines Laptops überraschender Weise die gesamte Zeit durchhielt, versagte das WLAN nach der Hälfte der Stunden – wie schön es doch ist mobile Daten zu haben.
Dienstag 20.02.2024 – Catching Waves
Als ich aus meinem Zelt kroch und den auf den Parkplatz aufpassenden Guard fragte, ob ich nicht noch eine Nacht dranhängen könnte, lehnte dieser ab. Sein Chef sei gestern vorbeigekommen und hätte sich an dem Zelt gestört. Ich könne mein Zelt abbauen, den Rucksack hierlassen und das Zelt am Abend wieder aufbauen, doch diese Komforteinschränkungen bin ich nicht bereit in Kauf zu nehmen und so verlasse ich den Parkplatz. Nachdem die gestrigen Nachhilfestunden ordentlich Geld in meine Kasse gespült haben, will ich mir heute etwas gönnen und hatte eine Surfstunde gebucht. Allerdings würde diese an einem anderen Strand stattfinden und so laufe ich erstmal eine Stunde die Küste entlang in Richtung „Malika Surf Camp“. Hier erklärte man mir, dass ich der einzige Teilnehmer der gebuchten Gruppenstunde sei und wir direkt loslegen könnten. Neoprenanzug an, dehnen, ein paar Trockenübungen machen, schon schreite ich mit dem Brett unterm Arm den großen Wellen des Atlantik entgegen. Vor etwa einem Jahr hatte ich im Urlaub in Peru schon einmal Surfstunden genommen – mehr oder weniger erfolgreich. Nach ein paar Versuchen, bei denen ich kopfüber im salzigen Wasser lande, komme ich rein und mir gelingt es immer öfter auf dem Brett stehend dem Strand entgegen zu fahren. Der Strand hier bietet einen wesentlichen Vorteil: Er ist ewig weit extrem flach und so spart man sich nach einer erfolgreichen Welle das anstrengende zurückpaddeln – was keineswegs heißt, dass das Laufen in dem welligen Wasser einfacher wäre. Vollkommen zufrieden kam ich aus dem Wasser – morgen wolle ich mir ein Brett mieten und alleine mein Glück versuchen. Während ich vor einem Auchan-Markt – der einzigen westlichen Supermarktkette hier – sitze, denke ich über meine Optionen für die Nacht nach. Der Segelclub war zu weit außerhalb um morgen noch einmal hier her zu kommen, doch wieder auf den Parkplatz zurückkehren wollte ich irgendwie auch nicht. Ich schreibe also noch einmal die Surfschule an und fragte, ob ich nicht an dem dazugehörigen Strand zelten könne und die Toilette, sowie das WLAN des eignen Surfhostels, welches mir mit knappen 25€ pro Nacht zu teuer ist, nutzen könne. Und tatsächlich: Gegen ein Entgelt von 5000 Franc (7,64€) ließ man sich auf meine Pläne ein. In dem Surfhostel erwarteten mich sämtlich freundliche Reisende, gutes WLAN, ein schöner Graten mit Hängematten und eine unglaublich familiäre Atmosphäre – hier unterzukommen muss traumhaft sein. Am Abend baue ich dann am Strand mein Zelt auf. Gerade als ich mich in den Schlafsack verkrochen habe, zündet jemand wenige Meter weiter ein kleines Lagerfeuer an und so krabble ich wieder aus meinem Zelt. Bis in den späten Abend sitze ich bei dem Künstler, der den hier am Strand liegenden Müll in Kunst verwandelt, zusammen am Feuer und schaue der lodernden Flamme zu.
Mittwoch 21.02.2024 – Übung macht den Meister
Neuer Tag, neues Glück! Auch heute will ich mich wieder am Surfen versuchen – aber diesmal alleine. Nachdem ich mir zum Frühstück, schnappe ich mir eines der Bretter und steige in meinen Neoprenanzug. Die Wellen scheinen heute größer zu sein, als gestern und auch den langen flachen Strand vermisse ich – schon nach einigen Metern muss ich das Schwimmen beginnen. Erste Welle, erster Versuch, Platsch! Nächste Welle, ein neuer Versuch, und wieder: Platsch! In meiner Brust merke ich derweil den Muskelkater, der gestrigen Stunde – wo man nicht überall Muskeln hat. Nachdem ich zum gefühlt zehnten Mal kopfüber in den reißenden Wellen gelandet bin steigt die Frustration. Doch, was solls? Das ist eben das Lernen nach dem Try & Error Prinzip – in meinem Fall mit viel Error. Irgendwann schaffe ich es tatsächlich eine Welle zu bekommen und komme stehend bis kurz vor den Strand. Dann wieder eine Handvoll deprimierender Fehlversuche. Immer wieder reißen mich riesige Monsterwellen selbst im liegen vom Brett und schütteln mich durch, wie eine Waschmaschine. Obendrauf kommt, dass die Wellen treffen heute nicht parallel, sondern im 45° Winkel auf den Strand treffen, und ich so mit jeder Welle ein Stück weiter abtreibe. Nach etwas mehr als zwei Stunden reichts mir. Immerhin zehn Wellen hatte ich bändigen können – noch weit von meinen Zielen entfernt doch die afrikanische Atlantikküste mit ihren Surfspots ist noch lang. Übung macht den Meister! Vollkommen fertig lasse ich mich in dem Surfhostel nieder und genieße das schnelle Internet. Mit dem Taxi mache ich mich am Nachmittag auf den Weg zu dem Segelclub, bei dem ich bereits die ersten Nächte gezeltet hatte, und lasse mich wieder einmal gnadenlos vom Taxifahrer abziehen. Diesmal war ich mit der Aussage „3000 Franc“ (4,57€) eingestiegen und zahlte schlussendlich 5000 Franc (7,62€) für die zwölf Kilometer lange Strecke. Die drastische Preissteigerung rechtfertig der Taxifahrer mit dem dichten Verkehr: „Das hat lange gedauert“ „Ja, aber was kann ich dafür? Werden Taxipreise nicht nach Kilometern berechnet?“. Dazu hatten er ganze zehn Minuten damit verplempert den Reifen seines Taxis aufzupumpen – das würde ich das als Grund für einen kräftigen Rabatt sehen. Doch, es hilft nichts – Taxifahrer würden wohl nie meine Freunde werden.
Donnerstag 22.02.2024 – Ranz ist der neue Glanz
Den heutigen Tag hatte ich mir reserviert um ein paar Dinge zu erledigen und zur Ruhe zu kommen, bevor ich Dakar morgen wieder verlassen würde. Als Erstes standen ein paar Arbeiten am Laptop auf meiner Liste: Blog veröffentlichen, Bilder sichern, und vor allem Updates machen. In den letzten Wochen war die Arbeitsgeschwindigkeit meines Laptops aufgrund fehlender Updates drastisch gesunken und auch der App Store meines Handys verlangte nach mehr als 30 App-Updates. Ups! Mit dem Ziel Mückenschutzmittel zu kaufen machte ich mich auf den Weg zum nächsten größeren Supermarkt und gönnte mir neben dem DEET-haltigsten Mückenschutz, den ich finden konnte auch gleich eine Flasche Bouye-Saft. Der leicht säuerliche Fruchtsaft wird aus den als „Affenbrot“ bekannten Früchten des beeindruckenden Baobab-Baumes gewonnen, der unter anderem auf dem senegalesischen Nationalwappen zu finden ist. Zurück auf dem Campingplatz hatten sich zwei große Overlander-Trucks. Allradantrieb, einen knappen Meter Bodenfreiheit, Reifen größer als mein Zelt – während ich die Fahrzeuge vor einigen Wochen noch bewundert hatte, stelle ich mir inzwischen die Frage wofür man das alles braucht, wenn man doch scheinbar alle Straßen auch mit einem schrottreifen und absolut überladenen Peugeot aus der Nachkriegszeit passieren kann. Zumindest habe ich bisher keine Straße in Westafrika gefunden, in der einem ein solches Gefährt nicht entgegenkam. Beim einem Blick auf mein Equipment fiel mir auf, in was für einem Ranz ich inzwischen lebte. Mein Zelt war matt vom daran klebenden Staub und dem Vogelkot. Jedes Mal, wenn ich ein Kabel in meine Powerbank steckte, knirschte es. Der Stift meines Laptops hatte den hohen Temperaturen beim Laden nicht standgehalten und war geschmolzen. Auf meinem Körper lag – trotz regelmäßigem Duschen und Schwimmen – eine Schicht aus Sonnencreme, Mückenschutz und Desinfektionsmittel, die optimalen Halt für den trockenen Staub bot. Vom Geruch meiner Schuhe oder meines Handtuchs schweige ich mal lieber. Afrika hatte mich und meine Ausrüstung voll in Beschlag genommen. Wie heißt es so schön? „Ranz ist der neue Glanz!“ Ein letztes Mal setzte ich mich auf den hölzernen Steg und guckte Honigmelone essend dem Sonnenuntergang zu!
Freitag 23.02.2024 – Frauenkloster
Schon kurz nach Sonnenaufgang packte ich meine Sachen zusammen und verließ den Campingplatz. Den einstündigen Marsch in Richtung „Gare Routiere“ wollte ich schließlich nicht in der Mittagssonne durchziehen müssen. Am Busbahnhof findet sich schnell ein Fixer, der mich dem richtigen Sept-Place-Taxi zuwies. Bei den Sept-Place-Taxis – von Deutschen auch gerne als Buschtaxi bezeichnet – handelt es sich in der Regel um einen alten sich im technisch prekären Zustand Peugeot 505 Kombi, dem mittels einiger Schweißkünste eine dritte Sitzreihe hinzugefügt wurde. Sieben Fahrgäste plus Fahrer und Gepäck passen so in den ursprünglich mal auf vier bis fünf Leute ausgelegten Wagen. Ich ziehe das große Los – Hintere Reihe, Mittelplatz, mein Kopf wäre ausgeklappt 20 Centimeter höher als der Dachhimmel. Immerhin kostet mich die eineinhalbstündige Fahrt ins 90 Kilometer entfernte M‘bour so nur 3000 Franc (4,57€)., Mit jedem Meter wird die Steppe etwas grüner, Rinderherden laufen durch das dichte Buschwerk, immer wieder stehen gewaltige Baobab-Bäume am Straßenrand. In M’bour setzte ich mich erstmal einige Minuten in den klimatisierten Auchan-Markt, bevor ich mir die Moschee angucke. Mit einem prachtvollen Palmengarten gesäumt, ist diese – neben dem Fischmarkt, doch von Fischmärkten hab ich erstmal genug – die Hauptattraktion der 230.000 Einwohner Stadt. In einem Bus – andere würden von einem alten Mercedes-Lieferwagen sprechen, in den man ein paar Sitzbänke geschweißt hat – soll es weitergehen. Mehr Sitzplätze bedeutet länger warten, denn kein Fahrzeug fährt hier, ohne dass nicht jeder Platz besetzt ist – zum Glück füllt sich die Blechkiste doch einigermaßen schnell. Irgendwann während der Fahrt fällt mir auf, dass ich im Senegal noch gar keinen Checkpoint durchquert habe. Während die routinemäßigen Polizeikontrollen in Marokko und Mauretanien mindestens zweimal – manchmal auf sechsmal – pro Fahrt stattfanden, hat im Senegal – abgesehen von dem Grenzbeamten – noch kein Beamter meinen Pass sehen wollen. An meinem Ziel, dem kleinen Fischerdorf Joal Fadiout, angekommen, mache ich mich auf die Suche nach einem Koster am Rande des Ortes. Meinen Informationen zufolge soll es dort möglich sein, im Innenhof zu campen. Und tatsächlich: Kaum habe ich die Wörter „Camping“ und „Zelt“ weißt mir eine freundliche Nonne einen Platz zu. Den Abend über sitze ich vor meinem Zelt und gebe, immer zwischen dem schwächelnden WLAN und mobilen Daten wechselnd, Nachhilfestunden während eine Armee an Mücken mir derweil den Krieg erklärt.
Samstag 24.02.2024 – Muschelinsel
Meinen Tag beginne ich direkt mit der Hauptattraktion – zwei zu dem Dorf gehörende Inseln, die nur aus Muscheln bestehen. Für den Weg über eine kleine Holzbrücke zahle ich 5000 Franc (7,62€), dann darf ich die zur Touristenattraktion gewordenen Inseln betreten. Während die größere Insel, auf der sich das Dorf befindet, wenig spannend ist, strahlt die kleine Friedhofinsel eine einzigartige Atmosphäre aus. Der gesamte Friedhof besteht nur aus Muscheln. Riesige jahrhundertalte Baobab-Bäume haben zwischen diesen Wurzeln geschlagen und bilden heute ein perfektes Fotomotiv. Gegen Mittag setzt Ödnis bei mir ein: Die meisten Meschen haben sich in der Mittagshitze in ihre Häuser zurückgezogen. Abgesehen von den recht kleinen Inseln gibt es in dem Dorf absolut nichts zu machen – vorausgesetzt man möchte nicht durch das knietiefe Wasser warten und Fische fangen. Auf der Suche nach einem kalten Getränk, kaufe ich mir eine Packung Milch für stolze 1500 Franc (2,29€). Bei genauerem Betrachten der quadrilingual bedruckten Verpackung fällt mir das DE im Herkunftskennzeichen auf. Tatsächlich: Importware, produziert in Niedersachsen zu einem Zeitpunkt zu dem ich noch kein Abi hatte – ein Exempel für Globalisierung. Als ich ein zweites Mal auf die Inseln zurückkehre, ist der Wasserstand bereits um einen knappen Meter gesunken – Joal-Fadiout liegt am äußersten Rande des Sine-Soulum-Deltas. Mit der Ebbe, bewegen sich die frei auf der Insel herumlaufenden Schweine ins Watt und suchen dort nach Essbaren. Auch ich mache mich auf die Suche nach etwas Essbaren – direkt hinter der Brücke hatte ich ein „Mafe“-Schild gesehen. Mafe soll ein traditionell senegalesisches Gericht sein, doch in den Restaurants, in denen ich frage weiß man nichts davon. Auch welchem Restaurant das Schild gehört ist unerkenntlich. Von einem Local lasse ich mich in eine Blechhütte führen, in der eine Frau im Licht einer alten 60W-Birne neben dem laufenden Fernseher günstig essen verkauft. Die Auswahl ist – wie so oft – beschränkt: Reis mit Fisch oder Reis mit Fisch. So langsam kann ich den angebrannten Reis und den grätigen, am Stück servierten, Fisch mit dem bis aufs letzte weichgekochten Gemüse nicht mehr sehen. Lustlos stochere ich im Essen herum und versuche die trockene Riesenportion herunterzubekommen. Als einzige Soße steht eine gelbe Flasche mit der Aufschrift „Piment extra fort“ auf dem Tisch, doch von der – das habe ich inzwischen gelernt – lasse ich lieber die Finger. Immerhin ist in meinem zwei Euro dreißig teuren Menu noch ein Beutel kaltes Wasser dabei. Das wird hier nämlich in kleinen 400ml Plastikbeuteln serviert, denen man eine Ecke herausbeißt und sie dann leer saugt. Am Abend gucke ich mir den Sonnenuntergang über dem Flussdelta an. Grüne Mangrovenwälder und ein paar durch das spiegelnde Wasser gleitende Piroguen – das erste Mal in Afrika verschwindet der sonst allgegenwärtige Sand ganz aus meinem Blickfeld.
Sonntag 25.02.2024 – Teranga
Zu Fuß verlasse ich das Dorf. Mein nächstes Ziel ist gerade einmal 25km von hier entfernt – die Buschtaxi Wartezeiten mit Pech länger als der Fußweg. Wie anstrengend der bei 40 Grad und praller Sonne ist, unterschätze ich allerdings gewaltig und so bin ich froh, als ich nach zwei Stunden Fußmarsch den „Baobab Sacre“ – den größten Affenbrotbaum im Senegal – erreiche, der direkt auf dem Weg liegt. Anstatt mir eine kühle Cola anzubieten versuchen mich geschäftstüchtige Locals zu überzeugen, durch ein Loch ins Innere des riesigen Baumes zu klettern. Doch ich trinke nur etwas, genieße den Schatten, mache ein paar Bilder und laufe dann weiter. Meinen Plan „Mar Lodj“ zu Fuß zu erreichen habe ich inzwischen zwar aufgegeben, doch ich will nicht direkt neben dem Volk schwätziger Touristenguides auf das nächste Sept-Place-Taxi warten müssen. Das kommt bereits wenige Minuten später und bringt mich für 500 Franc (0,76€) ins nächste Dorf. Eine Frau, die mein Zielort verstanden hat, nimmt mich dort unter ihre Fittiche und hilft mir in das nächste überfüllte Sammeltaxi zu kommen. Eine halbe Stunde später ist mein Ziel dann in Sichtweite. Nur noch das Wasser trennt mich von der inmitten des Sine-Soulum-Flussdeltas liegenden Insel „Mar Lodj“. Kurzerhand beschließe ich, dass für zumindest heute auf dem Festland bliebe und suche dort nach einer Bleibe. Auf Google Maps mache ich den Privatparkplatz einer Lodge ausfindig. Der dort aufpassende Guard tätig einen kurzen Anruf und zeigt mir dann einen Daumen nach oben – ich könne hier Zelten. Im Schatten einiger Bäume mit Blick auf die Lagune hilft er mir mein Zelt aufzubauen. Gerade als ich mich dann auf den Weg ins Dorf – auf die Suche nach Essen – machen möchte lädt mich Omar zu sich nach Hause ein. Im Schatten einer Palme sitze ich wenig später in seinem kleinen Garten und esse Reis mit Fisch. Zum Nachtisch schlägt Omar zwei Kokosnüsse von der Palme unter der ich sitze, und beginnt diese mit der Machete zu öffnen. Zurück auf dem Parkplatz zeigt mir Omar das Boot mit dem die Gäste zur Lodge gebracht werden – hier könne ich mich im Schatten ausruhen. Während ich in dem leicht schaukelnden Boot vor mich hin döse kommen erste Gäste. Gerade als ich das Feld räumen will, gebietet Omar mir sitzenzubleiben – die Fahren nur zur Lodge und zurück – du kannst mitfahren. Gemeinsam mit zwei französischen Touristen fahre ich also mit dem Boot zu einem der Luxus-Resorts. Dort steigen die beiden Franzosen aus und eine Familie steig ein. Zurück am Parkplatz steigt ein junges Paar inklusive Kind ins Boot und wir fahren wieder los – diesmal zu einer entfernteren Lodge. Fünfzig Minuten unterhalte ich mich mit dem Paar – endlich wieder flüssig Englisch sprechende Menschen – bevor wir ihre Unterkunft erreichen. Für meine erste Nachhilfestunde käme ich nicht mehr rechtzeitig zurück, die verschiebe ich also kurz. Pelikane und Kormorane sitzen am Ufer das von dichtem grünen Mangrovendschungel bedeckt ist. Ein paar Fischer stehen neben ihren Booten im knietiefen Wasser. Die sammeln Austern, erklärt mir der Bootsfahrer, der gleichzeitig Omars Bruder ist. Wenig später halten auch wir in den Mangroven und Omars Bruder beginnt mit einer Machete einige der bei Niedrigwasser freiliegenden mit Austern bewachsenen Mangrovenbüsche abzuhacken. „Mange“ (Essen) erklärt er mir „Parking, avec Omar, le soir“ (Parkplatz, mit Omar, heute Abend). Gerade rechtzeitig zu der nächsten Nachhilfestunde erreichen wir wieder den Steg. Danach sitze ich mit Omar und ein paar anderen Jungs am Lagerfeuer und beginne die in vielen Ländern als Delikatesse servierten Muscheln zuzubereiten – garnichtmal so schlecht. Weil ein paar Muscheln allein den Magen nicht füllen, nimmt Omar mich danach ein weiteres Mal mit Nachhause, wo er mir seine Familie vorstellt und wir gemeinsam Garnelen essen. Danach telefoniere ich kurz mit meiner Familie, bevor ich mich wieder ans Lagerfeuer setzte und den Abend dort bei einem Tee ausklingen lasse. „Terenga“ – das aus dem Wolof stammende Wort steht für eine besonders umfängliche Form senegalesischer Gastfreundschaft, die ich heute erlebt zu haben schien.
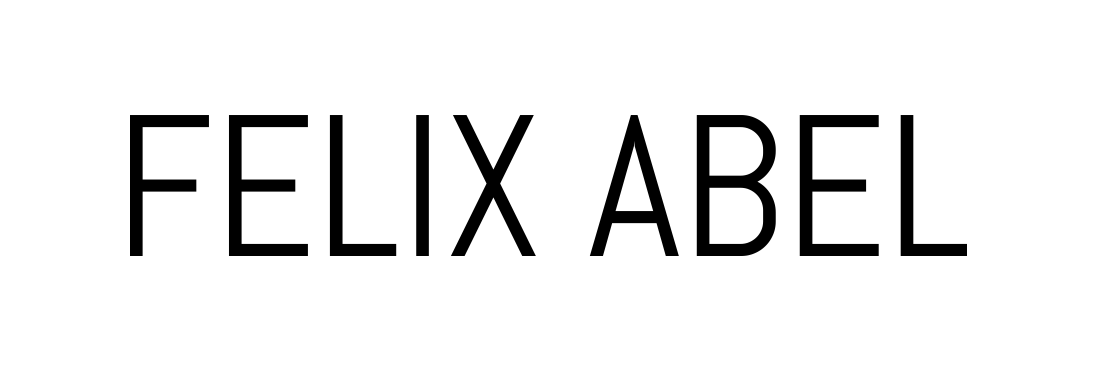

























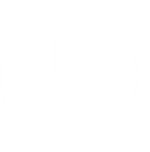


Wieder toll geschrieben!
Was für schöne Erlebnisse mit dem Surfen, den Muscheln, den riesigen Bäumen und dieser wunderbaren Gastfreundschaft. Könnte ich mir vorstellen hier jemand fremdes so gastfreundschaftlich zu begegnen? Übrigens hab ich Mafe schon gegessen.