Freitag 12.04.2024 – Jetlag
Früh am Morgen – das hat das Reisen so an sich – geht es los. Ich verabschiede mich von meiner Mutter und steige dann gemeinsam mit meinem Vater ins Auto. An der S-Bahn-Station in Eimsbüttel verabschiede mich dann auch von diesem und fahre von dort das letzte Stück zum Hauptbahnhof. Während ich auf meinen ICE warte, treffe ich in der Warteschlange des Bäckers auf mir bekannte Gesichter „Was macht ihr denn hier?“ Jan und Melli, ein Paar aus dem Tauchverein, sind auf dem Weg nach Köln – wo man sich nicht überall trifft. Während im ICE die Landschaft an der Fensterscheibe vorbeizeiht lasse ich die vergangenen zwei Wochen noch einmal Revue passieren: Ich war nach Deutschland geflogen, um meine nichtsahnenden Eltern auf ihrer Silberhochzeit zu überraschen. Daraufhin hatte ich zwei Wochen zu Hause verbracht, unzählige Freunde und Bekannte wiedertreffen dürfen und vor allem Zeit mit meiner Familie verbracht. Ich war tauchen gewesen und durfte im Gemeinschaftssaal die inzwischen fertigen Renovierungsarbeiten begutachten. Überall wo ich hinkam hatte ich etwas zu erzählen gehabt. Die Zeit in Deutschland und vor allem die vielen Begegnungen hatten gutgetan, nachdem ich die vorherigen Wochen oft alleine unterwegs gewesen war. Doch genauso freute ich mich nun zurückzukehren und meinem Ziel die Erde zu umrunden weiter nachzujagen. Fünf Stunden später stehe ich am Frankfurter Flughafen. Die Deutsche Bahn war pünktlich – ich habe viel zu viel Zeit. Im Nullkommanichts habe ich meinen Rucksack abgegeben, die Sicherheitsschleuse und die automatisierte Passkontrolle hinter mir und warte an meinem Gate. Es ist ein komisches Gefühl: Das was vor zwei Wochen noch mein Alltag war scheint nun schon wieder so fern zu sein. Mit dem Sonnenuntergang lande ich in Casablanca und warte dort auf den nächsten Flieger. Wer denkt, dass dieser Um-die-Welt-jetten-Lifestyle Spaß macht, täuscht sich. Man könnte den heutigen Tag auch so formulieren: Ich habe eine Stunde im Auto darauf gewartet, in Hamburg anzukommen, um dann eine halbe Stunde auf meinen ICE zu warten. Sobald der da war, habe ich fünf Stunden darauf gewartet in Frankfurt zu sein, um in Frankfurt dann darauf zu warten, vier Stunden auf die Landung in Casablanca, eine Stunde auf den zweiten Flug und dann weitere vier Stunden auf die Landung in Bissau zu warten.
Samstag 13.04.2024 – Back in Africa
Um ein Uhr Nachts setzt mein Flugzeug ziemlich unsanft in Bissau auf. Nach etwas skeptischen Blättern in meinem Reisepass, drückt die Beamtin meinen zweiten Guinea-Bissau-Einreisestempel in meinem Pass – ich bin zurück in Afrika. Am Flughafen verhandle ich mit vier Taxifahrern, bevor ich das Gelände schlussendlich zu Fuß verlasse. Einer der Taxifahrer fährt mir nach und bringt mich dann vor sich hin murrender Weise doch noch zu dem von mir gefordertem Preis zum Hostel. Nach etwas Schlaf beginnt am Morgen dann wieder mein Bissau-Alltag: Beim Bäcker hole ich mir etwas zum Frühstück, dann gebe ich drei Nachhilfestunden. Ich hatte Afrika vor zwei Wochen mit dem selben Budget in der Reisekasse verlassen, mit dem ich es vor drei Monaten betreten hatte – so weit, so gut. Doch die nächsten Tage – ich wollte einige Kilometer schrubben – würden nicht günstig werden. In der Mittagssonne laufe ich zum Markt und mache mich auf die Suche nach einer mir unbekannten Frucht, die ich vor zwei Wochen mit Christian hier entdeckt hatte. Exotisch und lecker soll sie schmecken, schwer vergleichbar mit irgendetwas anderem, dazu ist sie extrem empfindlich und keineswegs Massenware, wie zum Beispiel die überall erhältlichen Mangos. In Handtücher eingewickelt und in einer Kiste versteckt, hüten die Marktfrauen, die scheinbar namenlose Frucht wie einen Schatz. Tatsächlich gelingt es mir das einzige heute auf dem Markt erhältliche Exemplar aufzutreiben und ich kann im Hostel eine Bilderkennungsapp befragen, um was es sich bei meiner Errungenschaft handelt: Guyanabana – zu Deutsch: Stachelannone. Geschmacklich stimme ich anderen Berichten zu: Leicht säuerlich, einzigartig, sehr lecker, aber auch nichts, was mich vom Stuhl haut. Am späten Nachmittag gebe ich noch eine weitere Nachhilfestunde, bevor mich noch einmal in die Stadt begebe. Bissau wirkt heute irgendwie wie ausgetauscht. Selbst in der vor zwei Wochen noch menschenleeren Altstadt stehen nun überall kleine Stände. Kinder spielen auf der Straße, alle Menschen sind schick gekleidet und in Feierlaune. Normaler Sonntag? Nachwirkungen des Zuckerfestes? Oder ist mir irgendwas entgangen? In einer mir noch unbekannten Nebenstraße finde ich einen europäisch eingerichteten Spar-Supermarkt. Ordentlich aufgereiht liegen acht Milka-Tafeln auf ein ganzen Regalboden verteilt. In der Etage darüber gibt es ziemlich zertrümmerte Schokoweihnachtsmänner – bis die Osterhasen hier angekommen sind, ist bei uns wahrscheinlich schon fast wieder Weihnachten. Im Fußballstation der Stadt laufen gerade die Vorbereitungen für ein großes Konzert. Auf dem Rückweg zum Hostel treffe ich auf einem Stand mit frischer Zuckerwatte – da muss mein inneres Kind einfach zuschlagen.
Sonntag 14.04.2024 – Plattfuß
Mit dem Sonnenaufgang stehe ich auf, und beginne langsam aber sicher meine Sachen zu packen. Fast einen Monat ist es schon her, dass ich zum ersten Mal in das Hostel hier in Bissau eingecheckt hatte – Zeit weiterzuziehen. Das Zelt ist abgebaut, mein Rucksack gepackt, nur der Manager lässt sich nicht auffinden. Ihm hatte ich, als ich nach Deutschland geflogen war, meinen Gaskocher anvertraut und den hätte ich jetzt gerne zurück. Eine Dreiviertelstunde muss ich warten, bis der freundliche junge Mann irgendwann auftaucht und mir den Kocher in die Hand drückt. Zu Fuß laufe ich die Hauptstraße entlang aus der Stadt heraus. Ein Taxi ist mir zu teuer und die Collectivos – innerstädtische Sammeltaxis, die hier im Minutentakt angeblich feste Routen entlangfahren – sind nicht beschriftet. Aber selbst wenn, sie das wären … ich weiß ja nicht einmal wie der in der iOverlander-App als Busstation gekennzeichnete Ort, der mein Ziel ist, hier heißt. Nach einer Stunde Fußmarsch entdecke ich schweißüberströmt die großen Reisebusse am Straßenrand. Wer jetzt an den Komfort eines deutschen Reisebusses denkt, liegt falsch. Zusätzlich zu den vollständig belegten Sitzen, gibt es im Mittelgang eine Reihe, in der die Fahrgäste auf Wasserkanistern oder – so wie ich – Fässern sitzen – so kriegt man nochmal 25 Leute mehr rein. Als ob das nicht schon eng genug wäre, quetschen sich dazu noch Straßenhändler durch den Gang des stehenden Busses. Erst als dieser die Türen schließt und die Fahrt beginnt, lichtet sich das Chaos und jeder findet sich auf seinem Platz ein. Nach zwei Stunden Fahrt knallt es auf einmal, der Bus beginnt zu ruckeln und bleibt wenige Meter weiter vollends stehen – unser Reifen ist geplatzt. Alle steigen aus, setzten sich in den Schatten, der Fahrer kramt den Wagenheber heraus. Zwei Leute beginnen zu arbeiten, zehn weitere Stehen im Kreis mit Händen in den Taschen drumherum – typisch Afrika. Eine Frau, die neben mir im Schatten sitzt bietet mir Cashew-Früchte an. Die sehr fruchtig schmeckenden Überbleibsel der Cashew-Nuss-Ernte haben eine kaugummiartige Konsistenz – ich bleib dann doch lieber bei den Nüssen. Gerade diskutiere ich mit einem ein paar Worte Englisch sprechenden Mitreisenden, ob wir wohl einen Ersatzreifen dabeihaben und wie lange unser Zwischenstopp noch dauern mag, da lädt man das Ersatzrad aus – Hoffnung! Trotzdem dauert es satte eineinhalb Stunden bis der neue Reifen sitzt und wir weiterfahren können. Nach weiteren vier Stunden Busfahrt nähern wir uns langsam meinem Ziel. Immer wieder lädt mein Sitznachbar, Lamine, der als Arzt bei einem Hilfsprojekt arbeitet, mich ein, dass ich heute Nacht bei ihm bleiben könnte. Doch ich lehne ab, ich möchte so dicht an der Grenze bleiben, wie möglich. Kurz vor meinen Ziel – dem letzten größeren Ort vor der Grenze – fahren wir an einem wunderschönen Wasserfall vorbei. Doch noch bevor ich aussteigen kann fahren wir schon weiter. In Quebo, meinem Zielort, angekommen steige ich aus und mache ich mich direkt auf die Suche nach einem Motorad-Taxi, dass mich die 20km Meter zurück an den Wasserfall bringen soll. 7000 Franc (10,67€) verlangt man dafür von mir – Wucherpreise. Die einzige Alternativoption sei Trampen heißt es – ich warte also auf ein Auto. Keine fünf Minuten später kommt ein weißer Geländewagen mit EU-Logo auf der Seite angefahren und hält an. Ich mache die Tür auf und beginne zu lachen. Der Fahrer ist Lamine, mein Sitznachbar aus dem Bus. Er lebt nicht, wie ich verstanden hatte in einem anderen Dorf, sondern hier in Quebo. Ich steige ein, wir bringen meine Sachen zu ihm nach Hause und fahren dann zu dem Wasserfall. Derweil organisiert Lamine mir schon ein Mototaxi, dass mich morgen über die Grenze nach Guinea bringen würde. Später am Abend werde ich noch zum Essen eingeladen und verbringe die Nacht dann in meinem Zelt auf Lamines Terrasse.
Montag 15.04.2024 – Höllenritt über die Grenze
Pünktlich um Acht bringt mich Lamine zur Mototaxi-Station und ich verabschiede mich von ihm. Hinten auf dem Motorrad geht es dann erstmal zum Haus meines Fahrers. Schon auf dem fünfminütigen Ritt, treibt es meinen Puls auf 180 und sehe mein Leben am seidenen Faden hängen. Wie soll das erst die nächsten drei Stunden werden? 25.000 Franc (38,12€) muss ich für die Fahrt nach Boke, dem nächsten Ort auf der anderen Seite der Grenze hinblättern. Mein Fahrer zieht sich derweil Lederkleidung an – den Helm bekomme dann aber ich. So haben wir zumindest zusammen eine vollständige Schutzkleidung. Nachdem das Zweirad getankt ist geht es los. Auf noch recht vernünftigen Schotterpisten erreichen wir Gandembel – die letzte kleine Siedlung vor der Grenze. In einem kleinen Strohdachhäuschen wartet der bissausche Grenzbeamte und drückt mir den Ausreisestempel in den Pass. Ab hier geht es nun noch auf einer Art Trampelfahrt weiter – deswegen heute auch mit dem Motorrad und nicht im Auto. Zehn Kilometer später folgt ein rostiges Schild das auf die Grenze hinweist. Hundert Meter weiter sitzt ein Mann in Uniform der mir ohne etwas zu tun 1000 Franc (1,52€) – wofür auch immer – abkassiert. Eine weitere halbe Stunde fahren wir den schmalen Pfad entlang durch den Dschungel. Immer wieder durchqueren wir trockene Flussbetten vorbei an maroden Holzbrücken – diese Grenze in der Regenzeit zu passieren, muss eine Challenge sein. Nach weiteren zwei Checkpoints an denen man meine Visa- und Passdaten in ein Buch schreibt und jeweils ein kleines Scheinchen fordert, kommen wir an einen Fluss. Hier wird das Motorrad in ein Holzboot – der Boden mit Wasser bedeckt – geladen und dann rüber gepaddelt. Im Gegensatz zu Guinea-Bissau ist Guinea recht bergig und vollständig mit dichtem grünen Dschungel bedeckt. Der schmale, mal im 45° Winkel hoch und runter gehende Pfad, der sich durch den Dschungel schlängelt, die kleinen – oft nur aus wenigen strohgedeckten Lehmrundhütten bestehenden – Dörfern, an denen wir vorbeifahren – ich könnte tausende Fotos machen – so stellt man sich das tropische Afrika vor – doch ich bin viel zu beschäftigt damit mich an meinem Fahrer festzukrallen. Zehn Kilometer hinter dem Fluss kommen wir dann an den echten Einreise-Punkt. Ein freundlicher Offizier guckt sich mein vorher online beantragtes und bezahltes E-Visa an, und stempelt dann – ganz ohne Scheinchen – meinen Reisepass. Zwanzig Minuten später wird aus dem schmalem Pfad eine breite Schotterpiste. Hunderte Baumaschinen und Arbeiter setzten hier ein Bauprojekt von A7-Ausmaßen um: Eine fünfspurige Schotterautobahn. Für meinen Fahrer ist die breite Piste ein Anlass ordentlich Gas zu geben – ich krall mich noch fester an ihn. Zwei Stunden rasen wir – mal auf, mal neben der neunen Straße – mit beachtlicher Geschwindigkeit in Richtung Boke. Froh, dass die Fahrt nun ein Ende hat, steige ich vom Motorrad und mache mich direkt auf den Weg zur ersten Bank. Eigentlich war mein Plan heute meine erste Million zu machen – eine Million Guinea Franc sind etwa 120€ – doch der Geldautomat hat ein Limit von 600.000 Guinea Franc (65,57€) – also doch nur eine halbe Million. Am Nachmittag habe ich zwei Nachhilfestunden, allerdings gibt es in Guinea fast nirgends WLAN – ich brauch also zügig eine SIM-Karte. Der offizielle Orange-Store ist gnadenlos überfüllt – hier wird das innerhalb der nächsten zwei Stunden nichts. In einem kleinen Hinterhofladen finde ich dann jemanden der mir für 100.000 Franc (10,93€) eine Sim-Karte mit 4,5 Gigabyte Datenvolumen verkauft. Auf den Straßen ist es überall laut und extrem heiß – ich lasse mich also in einem kleinen klimatisieren Getränke-Laden nieder, in dem ich vorher etwas zu trinken gekauft hatte. Auf einem Plastikstuhl darf ich neben dem Tresen sitzend in etwas ruhigerer – von leise kann dennoch keineswegs die Rede sein – meine Nachhilfestunden geben. Gegen Abend mache ich mich auf die Suche nach einen Schlafplatz. Nach den heutigen Ausgaben verordne ich mir Sparmaßnahmen und so sind mir selbst die fünf Euro, die ich zahlen soll um neben einem Museum zu zelten zu fiel. Einer der nächsten Leute, die ich frage, lädt mich spontan auf sein Motorrad und fährt mich zu einem am Rande der Stadt gelegenen Hotel. Als er dann versteht, dass ich zelten möchte und nicht für 30€ ein Hotelzimmer nehmen, nimmt er mich noch weiter mit aus der Stadt raus und bringt mich zu einer Baustelle. Gemeinsam mit einem Polizisten bewacht ein Freud von ihm hier das Fundament eines zukünftigen Bürokomplexes – hier könnte ich sicher zelten. Ich baue also mein Zelt neben dem Bauzaun auf, während der mit Maschinengewehr bewaffnete Polizist und der Freund sich mir voll und ganz verpflichten – wenn du etwas brauchst, sag Bescheid. Als ich nachdem ich etwas essen war – abgesehen von zwei geschmolzenen Schokoriegel bin ich dazu heute vor lauter Sorgen um Grenzübertritte, Internet und Schlafplätze nämlich noch gar nicht gekommen – zu der Baustelle zurückkehre, steht neben meinem Zelt bereits ein Plastikstuhl, ein Brauchwasserkanister und ein Sack voll Trinkwasserbeutel. Für manche mag es unverständlich sein, warum ich lieber auf Baustellen zelte als mir für fünf Euro ein „schönen“ Schlafplatz zu gönnen, doch für mich machen die Menschen den Unterschied: Während man in vielen kommerziellen Unterkünften nur auf meinen Geldbeutel guckt, werde ich auf Parkplätzen und Baustellen meist freundlich umsorgt.
Dienstag 16.04.2024 – Auf ins Paradies
Ich wache mit einem ungewohnten Gefühl auf: Nässe. Ist heute Nacht der erste Regen gefallen oder sorgt die etwas höhere Lage Bokes dafür, dass mein Schlagsack klamm ist und auf meinem Zelt einige Wassertropen zu sehen sind? Ich müsste wohl oder übel von nun an wieder eine Plane über das Zelt machen. Generell startet der heutige Tag nicht besonders gut: Ich habe etwas Durchfall und eine Toilette gibt es auf der Baustelle natürlich nicht. Meine Notdurft muss ich also im Freien versteckt hinter dem Bauzaun verrichten. Dazu kommt ein Unsicheres Gefühl: Ich möchte die nächsten Tage auf einem kleinen Campingplatz irgendwo an der Küste zwischen Boke und der Hauptstadt Conakry verbringen. Wie der Ort heißt, wo der Campingplatz ist, weiß ich nicht, geschweige denn wo hier das „Gare Routiere“ – die Buschtaxizentrale – ist. Meine mobilen Daten möchte ich mir für Nachhilfestunden aufsparen. Obendrein hat mein Handyakku hat schon am Morgen nur 30% – und alle meine Powerbanks sind leer. Ich habe das Gefühl noch nicht angekommen zu sein in Guinea. Der Polizist, der die Nacht über mich gewacht hat, erklärt mir den Weg zum Gare Routiere und verrät mir auch gleich, dass heute Nacht kein Regen gefallen ist. Wenig später sitze ich einem Sept-Place-Taxi in Richtung Conakry. Nach einer Stunde Fahrt steige ich an einem Kreisel mitten im Nirgendwo aus. Kaum habe ich die Tür aufgemacht schon stürzen sich eine Handvoll Mototaxi-Fahrer auf mich. Schonwieder Mototaxi fahren? Doch als ich sehe, dass mein Ziel noch 30km entfernt ist, scheint mir die 30.000 Guinea Franc (3,28€) teure Direktpassage mit dem Motorrad eine willkommene Alternative zum Fußweg zu sein. Die Unterkunft entpuppt sich als wahres Paradies. Ein großes mit schattenspenden Palmen übersätes Grundstück, dazwischen einige Hängematten, günstige Preise, vier von vier Balken LTE-Netz und Blick auf den Strand. Neben mir beherbergt das von einer liebevollen älteren französischen Dame betriebene „Tombolya Village“ nur zwei weitere Gäste – einen guineischen Minenarbeiter mit weiblicher Begleitung, die hier ein paar Tage Urlaub machen. Während ich in der Hängematte vor mich hin döse, gibt der freundliche junge Mann, mir eine Cola aus. Ich setze mich zu ihm an den Tisch und stelle fest das Barry, so sein Name, sogar Englisch spricht. Wir unterhalten uns über seine Arbeit, das Land und seine Leute. Seine Ansichten wirken liberal und fortschrittlich „Nur weil du weiß bist hast du doch genauso Probleme – das verstehen hier nur viele nicht. Du hast andere Probleme, aber die sind deswegen ja nicht kleiner“. Sobald meine Cola leer ist, steht schon eine neue auf dem Tisch und als Barry sich und seiner Freundin Essen bestellt, bekomme auch ich eine Gabel. Zwischendurch springe ich immer in den inzwischen echt warmen Atlantik und gehe am ewig langen menschenleeren Sandstrand spazieren. Obwohl ich ihm beteuere, dass ich alles habe, was ich brauche, besteht Barry als wir uns am Abend verabschieden – er würde morgen zurückfahren – darauf mir noch drei weitere Dosen Cola zu kaufen, damit ich auch die nächsten Tage nicht verdurste.
Mittwoch 17.04.2024 – Absolut arm
Am Morgen mache ich mich auf den Weg in das direkt neben dem kleinen Paradies gelegene Dorf. Die Armut hier ist nicht zu übersehen. Die meisten Gebäude – wenn man das so nennen will – bestehen aus löchrigem Blech, zerrissenen Planen und alten Holzbretter, die irgendwie um ein Grundkonstrukt aus ein paar Holzstäben drapiert wurden. Hier zu leben ist für mich unvorstellbar. Kinder in zerrissenen dreckigen Klamotten winken mir zu, drücken ihre Freude einen Weißen im Dorf entdeckt zu haben, damit aus das sie mir Fote – mal wieder eine neue Bezeichung – hinterherrufen. Einige fassen mich sogar an – ob aus Neugier oder in der Hoffnung, dass nun irgendein Wunder geschieht, kann ich nicht beurteilen. Das erste Mal in meinem Leben sehe ich eine „Microbanque de Devélopment“ – ein Institut, dass durch gemeinsames Sparen der Dorfbewohnerinnen Mikrokredite verteilt, mit denen dann anfangs kleine, mit der Zeit immer größere Investitionen getätigt werden können. Meine Geografielehrerin hatte dieses Thema liebgewonnen und so habe ich mindestens eine Klausur und viele weitere Texte über diese Art von Entwicklungshilfe schreiben müssen. Die Bilder der Armut, die damals so unwirklich wirkend im Geografie-Buch abgedruckt waren, nun sah ich sie mit eigenen Augen. Für ein bisschen Heiterkeit in der demütigen Stimmung sorgt eine mit Logos der großen europäischen Fußballclubs bemalte Wellblech-Hütte. Innendrin ausgestattet mit einem Fernseher und einigen Holzbänken, finden hier Public Viewings der Champions-League Spiele statt. Für mich geht es zurück in die Unterkunft, den Luxus einer schattigen Hängematte und einer gekühlten schätze ich nun noch einmal mehr. Eine freudige Nachricht gibt es auf meinem Handy – ich habe eine Zusage von einem Couchsurfing-Host. Nach knapp vier Monaten Pause würde ich in Conacry das erste Mal in Afrika couchsurfen. Am Abend sitze ich mit Joelle – der Dame, die diesen Campingplatz ihr eigen nennen darf – am Tisch. Es gibt Fisch – aber auf französische Art. Das heißt: Mit Pommes und Grillgemüse – eine willkommene Abwechslung. Obwohl ich nur wenige Worte Französisch und sie nur wenige Worte Englisch spricht, unterhalten wir uns knapp zwei Stunden wunderbar, bevor ich mich in meinem Zelt verkrieche.
Donnerstag 18.04.2024 – Mosquito-Wahnsinn
Nachdem mich Vogelgezwitscher und Sonnenschein geweckt haben, hole ich mir im Dorf ein Schokolade bestrichenes Baguette zum Frühstück. Danach geht es zum Strand. Der weiße und entsprechend „Fote“ getaufte Hund von Joelle begleitet mich dabei Schritt auf Tritt, passt während ich Schwimmen bin auf meine Klamotten auf und folgt mir dann wieder zurück zur Unterkunft. Den Vormittag über habe ich nichts vor, außer … ich wollte mein irgendwann mal von der Dreckschicht befreien. Ich schnappe mir also einen Lappen wische zweimal über das Zelt, streiche den Punkt damit von meiner inneren ToDo-Liste und lege mich in eine der Hängematten. Das Leben ist so schön … wären da nicht diese Mosquitos. Mein ganzer Körper juckt, in erster Linie die Füße, aber auch sonst gibt es kein Körperteil, dass die tropischen Blutsauger verschonen. Eigentlich hatte ich gehofft, das Problem Mosquitos mit dem zu Goldpreisen gehandelten „AntiBrumm Ultra Tropical“, das ich mir aus Deutschland mitgebracht hatte, in die Vergangenheit befördert zu haben – doch dem scheint nicht so. Auge in Auge mit mir lassen sich die gestreiften Bestien immer wieder auf mir nieder – ob eingesprüht oder nicht. Ein genauerer Blick auf das Etikett des Mückenschutzmittels verrät mir einen möglichen Grund: „Für die handflächengroße Hautfläche eines Erwachsenen: 2 Pumpstöße“ – macht also insgesamt um die achtzig anstelle von den von mir als ausreichend befunden zwanzig Pumpstößen. Am Nachmittag gebe ich dann vier Nachhilfestunden. Für zwei meiner Schülerinnen rückt das Abi näher. Ich rechne also seit etwa zwei Wochen bayrische Abiturklausuren hoch und runter. In Kombination mit einem Übernachtungspreis von etwa drei Euro und einer Verdiensterhöhung von einem Euro pro Stunde – ein Dank für über 150 Nachhilfeeinheiten in sechs Monaten – glätten sich damit final die Wogen, die der Weg nach Guinea in meinem Portmonee gezogen hatte. Auch am heutigen Abend lasse ich mich wieder von Joelle bekochen: Europäische Küche; Spaghetti Bolognese satt – ein Gaumenschmaus. Joelle gibt mir auch noch den Tipp mir noch heute Abend einen Sitzplatz in dem Buschtaxi nach Conakry morgen zu reservieren – das ist manchmal schnell voll.
Freitag 19.04.2024 – Welcome to your Home
Um halb sechs klingelt mein Wecker – man hatte mir gestern erzählt, dass ich zwischen sechs und sieben da sein solle. Ich überlege kurz, schalte den Wecker aus und lege mich wieder hin. Ich muss nicht immer der Erste sein, ich kann doch auch mal der sein, auf den alle anderen warten müssen. Um sieben stehe ich dann auf packe meine Sachen und laufe zu dem Ort, wo die Buschtaxis stehen. Von meiner Reservierung weiß man hier nichts, aber man weißt mich einem neuen Taxi zu. Es fehlen noch vier weitere Fahrgäste und so heißt es: Warten. Derweil fährt das Buschtaxi in dem ich mir den Platz reserviert hatte, an mir vorbei zeigt mir den Zettel auf dem meine Telefonnummer steht, erklärt mir, dass ich nun ja ein anderes Auto gefunden hätte und düst ab. Hätte ich doch früher aufstehen sollen? Nach einer Stunde warten ist immer noch kein weiterer Fahrtinteressent aufgetaucht. Während ich genau das zu tun überlege, nimmt sich der einzige andere Fahrgast sein Gepäck wieder aus dem Kofferraum und nimmt ein Mototaxi. Fünf Minuten später sitze auch ich auf einem Motorrad, dass mich an die Nationalstraße bringen soll. Dort schreibe ich erstmal meinen Couchsurfing-Host, Abdre, an, wo genau in Conakry ich denn hinkommen solle. Anstatt mir eine Adresse zu geben, ruft Abdre an und erklärt einem der neben mir stehenden Männer auf Französisch was Sache ist. Der stoppt daraufhin für mich ein vorbeifahrendes Auto, dass mich an dem genannten Ort abliefern soll: Ein Mercedes-SUV mit Ledersitzen und Presse-Schild in der Frontscheibe – edel geht die Welt zugrunde. Nach drei Stunden Fahrt erreichen wir die Randbezirke Conakrys. An einer Kreuzung lässt mein Fahrer mich raus und organsiert mir ein erschwingliches Tuk-Tuk – die Dreirad Variante des Mototaxis – das mich weiter in die Stadt reinbringen soll. Als ich dort ankomme verlangt man von mir dann 60.000 (6,56€) anstelle der mir von meinem Fahrer genannten 8.000 Franc (0,87€) – ein nicht ganz unwesentlicher Unterschied. Nach einem Telefonat mit Abdre bringt mich ein weiteres Mototaxi zu einer nahegelegenen Apotheke, wo Abdre mich wenige Minuten später abholt. Gemeinsam fahren wir zu seinem Haus, wo man mir mein Zimmer zeigt. Wasser gibt es nur aus dem Kanister, Strom aufgrund eines kaputten Transformator nur von 18.00 bis 08.00 Uhr. Dafür gebe es – wenn Strom da ist – sogar Glasfaser-WLAN – eine Seltenheit hier in Guinea. Abdre stellt sich mir stolz als den CEO des „Le Courrier d‘Africque“ vor – der zweitgrößten Zeitung Afrikas. Weil er ausschließlich online arbeitet und der Strom nur Nachts geht, macht er fast jede Nacht durch und ist entsprechend durchgehend müde. In unserem Gespräch stellen wir auch gleich fest, dass die eine deutschsprechende Rucksackreisende, Marta, die ich im Hostel in Bissau kennengelernt hatte, ebenfalls hier war – erst vor vier Tagen sei sie abgereist. Marta ist inzwischen in Sierra Leone und berichtet von dort, dass es ohne Generator gar keinen Strom gibt – wie gut dass ich dieses Land auslassen würde. Am frühen Abend fahre ich mit Abdre zum Flughafen. Bei meiner Einreise über die Landgrenze hatte ich den Visasticker nicht bekommen – den muss ich mir nun am Flughafen holen. Am Flughafen schaffe ich es irgendwie in den Arrivals-Bereich zu kommen und stelle mich zu den gerade angekommen Fluggästen in die Schlange. Eine Stunde später klebt der Einkleber in meinem Pass und ich bekomme sogar einen zweiten Einreisestempel. Gemeinsam mit Abdre geht es zurück nach Hause. An den Straßenrändern Conakrys stehen überall kleine Stände. So kaufen wir aus dem Auto heraus, Datteln, Erdnüsse, gegrillte Fleischspieße und vieles mehr. Das ist auch nötig, denn für die sechs Kilometer zum Flughafen brauchen wir mit dem Auto eine knappe Stunde. Zuhause folgt eine Ernüchterung. Obwohl es bereits neun ist, ist noch immer kein Strom da. Es geht also im Dunkeln ins Bett.
Samstag 20.04.2024 – This is Africa
Es ist zwei Uhr. Ich wache durch das Surren der Klimaanlage und helles Licht auf – wir haben Strom! Als ich gegen sieben dann wirklich aufwache, deutet allerdings nur noch mein vollgeladener Handyakku darauf hin, dass ich vom Strom nicht nur geträumt habe. Den Morgen verbringe ich damit ein paar Nachhilfestunden zu geben. Abdre suche ich vergeblich – der schläft noch. Als ich gegen 11.00 Uhr mit meinen Nachhilfestunden durch bin, erdreiste ich mich dann doch zumindest mal an seiner Tür zu klopfen. Verschlafen erklärt er mir die Tagesplanung: Wir würden uns noch ein bisschen ausruhen – so, bis heute Abend – und dann das Nachtleben der Hauptstadt unsicher machen. Abdre verschwindet also wieder in seinem Zimmer, ich mache mich zu Fuß auf den Weg zu einem Geldautomaten – meine halbe Million ist alle. Am Geldautomaten kann ich diesmal immerhin 800.000 Guinea Franc abheben. Als ich zurückkomme und Abdre treffe, kommt dieser mir mit meiner Powerbank entgegen: „Ich hab mir deine Powerbank genommen, mein Handy war alle.“ Das ich mir den Strom exakt rationiere, damit ich meine Nachhilfestunden halten kann und mein Handy Akku hält, scheint ihm egal zu sein. Aber vor allem das Gefühl, dass man während meiner Abwesenheit ohne zu fragen in meinen Sachen rumwühlt, gefällt mir gar nicht. Ich würde in Zukunft meine Zimmertür also jedes Mal abschließen, wenn ich den Raum verlasse. Nachdem ich am Abend eine weitere Nachhilfestunde gegeben habe, steige ich mit Abdre ins Auto – nun würde das Abendprogramm beginnen – dachte ich zumindest. Abdre ist wild am telefonieren und versucht gleichzeigt irgendwie sein Handy auf über 3% Akkuladung zu bringen … achso, und Auto fährt er ja auch noch. Telefoniert er gerade nicht, so erzählt er mir wie arm er doch dran wäre: Sein Geld sei alle – er musste gerade eine Reparatur seines Zweitwagens bezahlen – und arbeiten könne er nicht, da der Strom letzte Nacht ja nicht zuverlässig funktioniert habe. Dann ist auf einmal sein Telefonguthaben alle. Nur leider gibt es gerade keinen Shop in Reichweite. Dazu ist es ist Gebetszeit – ein Teil der Shops hat also zu. Was ist mit dem Shop direkt neben seiner Haustür in dem ich heute Mittag mein Guthaben aufgeladen habe? Keine Ahnung. Vielleicht zu nah dran? Irgendwie lädt er die Karte dann doch auf, um schlussendlich doch einfach kurz bei dem Freund rumzufahren, den er so dringend anrufen musste. Von unserem Plan in eine Bar zugehen keine Spur. Auf meinen inzwischen leicht genervten Blick hin rechtfertigt er sich mit „This is Africa“ – die allgemeingültige Antwort auf alle Ungereimtheiten, die es hier gibt. „I love Africa – it’s freedom.“ fügt er hinzu. Doch kann vielleicht auch zu viel Freiheit einen am Ende Unfrei machen? In Bezug auf den Abend hat er nun neue Pläne: Wir würden zurück nach Hause fahren uns nochmal eine –oder vielleicht auch zwei – Stunden ausruhen und dann ins Nachtleben gehen. Nach zwei Stunden, die wir ohne irgendwo gewesen zu sein oder irgendetwas erreicht zu haben durch den dichten Verkehr gefahren sind, stehen wir also wieder zu Hause. Zumindest hier gibt es positive Neuigkeiten: Der Strom geht. Die erste Euphorie legt sich schnell als ich feststelle, dass es zwar nun WLAN gibt, dieses aber keine Internetverdingung hat. Einen Anruf später ist klar: Der Strom geht nun wieder, dafür gibt es bei dem Internetanbieter eine technische Störung. Wenn ich das erst nehmen würde, würde ich nun meine Nerven platzen, doch inzwischen Betrachte ich das alles mit einer Brise Humor. Ja, das ist wahrlich Afrika. Immerhin kämpft nun die Klimaanlage in meinem Zimmer gegen die 30° an und meine Powerbanks laden – damit kein WLAN zu haben, komme ich inzwischen klar. Gegen zehn dränge ich Abdre dann zum Aufbruch. Der ist dabei damit beschäftigt energisch mit irgendwem zu telefonieren. Wir holen einen seiner Freunde ab und fahren dann Richtung Bar. Unser Weg führt am Stadion der Stadt entlang in dessen gesperrte Zufahrtstraße Abdre stolz seinen Presseausweis präsentierend reinfährt. Wenig später kollidiert unser Auto mit einem Motorrad das Abdre übersehen hat. Der wütende Motorradfahrer sammelt ein Teil seines Fahrzeugs vom Boden auf, Abdre fährt einfach weiter. Als der Motorradfahrer sich an unser Auto krallt, gibt Abdre Gas und fliehen durch den Gegenverkehr. Derweil ist Adre selbstverständlich immer noch am telefonieren. Bereits gestern hatte Abdre auf dem Weg zum Flughafen ein anders Auto mitgenommen. Nun das und dazu keinerlei Schuldbewusstsein oder Einsicht. Ich überlege bei nächster Gelegenheit auszusteigen und nach Hause zu fahren. Ich bin sowieso einfach nur noch genervt – wir gurken schon wieder einfach in der Gegend herum während Abdre vor sich hin telefoniert – an Feiern mag ich gar nicht mehr denken. Irgendwie schaffen wir es dann doch noch an einen Strand an dem sich eine kleine Bar an die nächste reiht. Nach drei Bieren dränge ich zum Aufbruch. Abdre will noch in eine Lounge, ich bitte allerdings darum mich unverzüglich zu Hause abzusetzen. Mein „mangelndes Vertrauen“ stört Abdre – er fahre seit zwanzig Jahren Auto, schuld sei allein der Motorradfahrer. Ich wolle doch Afrika erleben, solle mich mal locker machen, so sei eben Afrika. Ich sehe nur eine Statistik von zwei Unfällen innerhalb von zwei Tagen, zuzüglich Fahrerflucht und einem Abdre, der mir vorhin – scheinbar nichtmehr ganz nüchtern – sein viertes Bier über die Hose gekippt hat. Irgendwo zieht „This is Africa“ nicht mehr, irgendwo ist das einfach nur noch bescheuert.
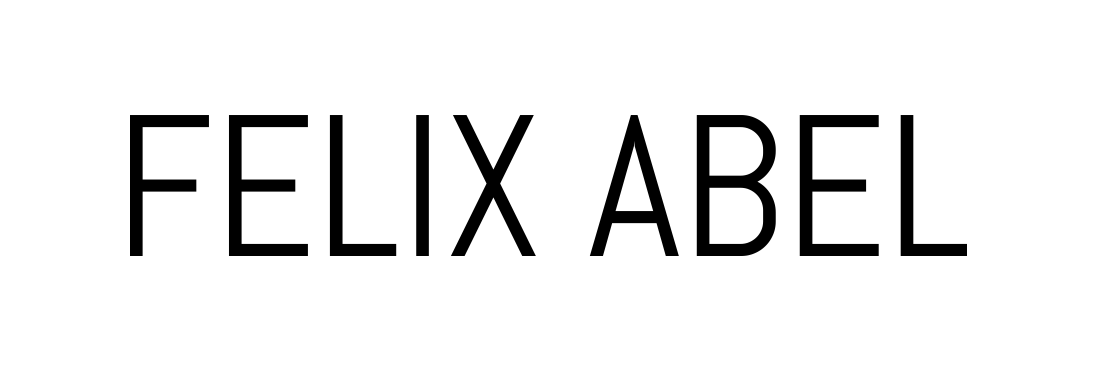













































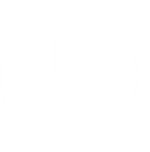


This is Africa 😍
Immer cool bleiben.
Ich glaub die Menschentypen die du triffst, gibts bei uns genauso. Deine Prise Humor gefällt mir.