Montag 05.02.2024 – “Once-in-the-Lifetime-Experience” zum zweiten Mal
Um kurz vor zehn checken wir aus unserem Hotelzimmer aus und lassen uns in einem kleinen Lokal an der Straße zum Frühstück nieder. Als ich nach Hostelpreisen für Nouakchott – unserem nächsten Ziel – gucke, fällt mir die Kinnlade runter. Ich schreibe Abdou, meinen mauretanischen Couchsurfing-Host aus Rennes in Frankreich, an und frage nach Empfehlungen. Seine Antwort „Don’t worry about Hostels. My brother can host you.“ – Entspannung macht sich in mir breit. Nachdem der morgendliche Hunger gestillt ist, besorgen wir noch eine Decke, medizinische Masken und Wasser. Die heutige Zugfahrt würde lang, kalt und vor allem dreckig werden. Ein Taxi bringt uns zu einem kleinen Abstellgleis, an dem der Zug halten soll. Im Hiergrund erheben sich die gigantischen schwarzen Berge, die das so begehrte Eisenerz beinhalten. Nach eineinhalb Stunden – pünktlich um 13 Uhr – kommt der Zug – allerdings ohne die vielen Waggons. Wir versichern uns kurz, dass das der richtige Zug sei und klettern dann in einen mit Reissäcken gefüllten Waggon. Nachdem wir eine Dreiviertelstunde durch die beeindruckenden Eisenerzminen Zouerats gefahren sind, kommt der zweite Teil des Zuges mit den Waggons und wir steigen in einen mit groben Eisenerz gefüllten Waggon um. Im Gegensatz zu dem feinen sandartigen Eisenerz erhoffen wir uns so etwas weniger Staub abzubekommen. Die Fahrt beginnt. An der Seite des Waggons graben wir uns zwei kleine Kuhlen ins Erz, die verhindern, dass wir heute Nacht beim Schlafen vom Waggon fallen. Die Fahrt in den vollen Waggons ist in vielerlei Hinsicht angenehmer: Der Zug fährt langsamer, es staubt überraschenderweise fast gar nicht, das Rütteln ist etwas gedämpfter, man kann ohne zu stehen die Aussicht genießen und vor allem kann man ohne klettern zu müssen zwischen den Waggons hin und her springen. Stundenlang genießen wir einfach nur, während die Wüste an uns vorbeizieht – so macht Zugfahren. Kurz vor Sonnenuntergang nutzen wir das goldene Licht für ein paar Fotos, die uns selber den Atem rauben. In der Dämmerung reichen wir Chom und nutzen den kurzen Stopp um unsere Thermounterwäsche unterzuziehen. Ab dann nimmt der Fahrspaß gewaltig ab. Es wird kälter, das Bett im Eisenerz ist uneben, überall drücken die Brocken. Das einzig gute an der Nacht der Sternenhimmel – doch den sehe ich durch den Turban, den ich mir übers gesamte Gesicht gezogen, habe nicht. Es dauert lange bis ich eine einigermaßen schmerzlose Schlafposition gefunden habe und ein paar Stunden schlaf bekomme.
Dienstag 06.02.2024 – Ausgeknockt
Ich wache zum sechsten Mal in dieser Nacht auf. Doch jetzt ist irgendetwas anders – Wir stehen! Ein Blick auf mein Handy verrät: 6 Uhr – Wir sind da! Schnell schnappen wir unsere in unzählige Mülltüten verpackte Rucksäcke und steigen von dem Waggon. Wenig später fährt das Kontollfahrzeug der Eisenbahngesellschaft an uns vorbei, hält an und bietet uns an uns in mit in die Stadt zu nehmen. Ohne weiter zu überlegen klettern wir auf die Pritsche des Pick-Ups und werden tatsächlich bis ins Stadtzentrum gebracht. Hans hatte den Eigner des Apartments, in dem wir die ersten Nächte verbracht hatten, angeschrieben und ausgehandelt das wir dort nun noch einmal duschen dürften. Ein gerade auscheckender Gast gibt uns den Schlüssel und wenig später läuft warmes Wasser über meinen Körper. Ich glaub ich hatte selten eine Dusche so nötig. Nachdem zumindest der gröbste Dreck und die schwarzen Stellen von meinem Körper verschwunden sind – für den Rest wird es noch mehre Duschen brauchen – mache ich mich auf den Weg in die Stadt, denn ich bin pleite. Nicht pleite pleite, aber mein mauretanisches Bargeld ist bis auf den letzten Ouguiya alle. Ich klappere drei Banken ab: Wenn man dort überhaupt einen Geldautomaten hat, dann ist dieser entweder gerade außer Betrieb oder er akzeptiert keine internationalen Karten. Nach einer Stunde erfolgloser Suche kehre ich erschöpft ins Appartement zurück, wo Hans derweil per Hand seine Kleidung gewaschen hat. In meinem Kopf höre ich noch immer das Brummen des Zuges – ich fühle mich wie das letzte Häufchen Elend. In einem Restaurant essen wir kurz etwas bevor wir uns einen Bus nach Nouakchott suchen. So fertig wie ich bin murre ich nicht einmal mehr als ich höre, dass der Transport ganze 700 Ouguiya (16,43€) kosten soll. Obendrauf fährt der Bus erst um 15.00 Uhr los und so starte ich einen zweiten Versuch Geld abzuheben. Drei weitere Banken, drei weitere nicht funktionsfähige Geldautomaten – Mist! Hans schießt mir das Geld für den Bus vor. Sechs Stunden dauert die Fahrt nach Nouakchott. Sechs Sunden in den ich schlafen will, aber – den von meiner eingequetschten Sitzposition bedingten Schmerzen in meinem Gesäß, sei Dank – keinen Schlaf bekommen kann. Endlich erreichen wir das nächtliche Nouakchott und ich schreibe Abdous Bruder an. „Kannst du ein Taxi nehmen?“ Ja … oder, warte … ich hab kein Bargeld! Für einen fünf Euro Schein bringt mich ein Taxifahrer zu meinem in einer recht luxuriösen Gegend lebenden Host. Dort angekommen zeigt man mir mein Zimmer und ich lege mich direkt ins Bett. Kaum hab ich die Decke über mich gezogen, klopft es, und man bringt mir ein Tablett mit Tacos und Pommes – da sag ich nicht nein. Wieder versuche ich einzuschlafen, wieder dauert es fünf Minuten, bis die Tür aufgeht und man mir ein Glas Saft reicht. Danach bekomme ich dann endlich meinen wohlverdienten Schlaf.
Mittwoch 07.02.2024 – Pleite
Mehrfach hatte man mir eingeschärft, dass Abdous Bruder um acht zur Arbeit und ich mit ihm das Haus verlassen müsse. So bin ich ein bisschen verwundert, als auch um neun Uhr noch Stille im Haus herrscht. Gemeinsam mit Abdous Bruder steige ich ins Auto – er würde kurz etwas erledigen mich dann zu einem Geldautomaten bringen und schließlich in einem Internetcafé absetzten. Zwei Stunden lang fahren wir von A nach B – immer wieder steigt Abdous Bruder aus, sagt mir ich solle kurz warten, verschwindet irgendwo und kommt zwanzig Minuten später zum Auto zurück. Anfangs versuche ich noch zu verfolgen, in welchem Stadtviertel wir uns gerade befinden und was er dort erledigen will, doch irgendwann gebe ich auf. Ich bin genervt: So, hätte auch selber zum Geldautomaten laufen können. Dann säße ich nun seit eineinhalb Stunden in einem Café und würde den Dingen nachgehen, denen ich nachgehen möchte. Beim gefühlt dreißigsten Stopp heißt es dann „Come!“. In insgesamt drei Banken versuche ich mich daran Geld abzuheben – erfolglos! Nach ein paar weiteren Stopps fahren wir wieder zurück nach Hause. Dort setzt mich Abdous Bruder in das Wohnzimmer des Nachbarhauses – das Haus seines Vaters – in dem es WLAN gibt und ich komme endlich dazu ein paar Dinge zu erledigen. Nach eineinhalb Stunden kommt Abdous Bruder zurück, nimmt mich mit in sein Haus und drückt mir in Alufolie eingepacktes Essen in die Hand – Reis mit Fisch. Für meine am Nachmittag geplante Nachhilfestunde darf ich wieder zu seinem Vater gehen – doch ich müsste auf dem Innenhof bleiben. Nach dem Unterricht erkunde ich auf eigene Faust die Stadt. Keine 500 Meter von Zuhause finde ich direkt einen Geldautomaten der mir doch tatsächlich unkompliziert und gebührenfrei 8000 frisch gebügelte Ouguiya ausspuckt – warum nicht gleich so? Die Innenstadt stellt sich als unspektakulär heraus. Graue Häuser, graue sandige Straßen, Massen von Müll und – abgesehen von einem wenig interessanten Platz vor dem Regierungspalast – nicht eine einzige Sehenswürdigkeit. Es scheint einen Grund dafür zu geben, dass Nouakchott im Internet als die „langweiligste Hauptstadt der Welt“ betitelt wird.
Donnerstag 08.02.2024 – Ein Meer aus Booten
Heute setzte ich meinen Plan tatsächlich um: Nachdem ich gefrühstückt hatte, machte ich mich auf den Weg in ein Internet-Café, dass man mir im Voraus empfohlen hatte. Seit über drei Wochen hatte ich nicht genug Internet gehabt, um meine Bilder zu sichern, jeden Tag lief ich mit der Angst rum, all die Bilder verlieren zu können – das wollte ich nun endlich wieder ändern. Auch dazu meinen Blog zu schreiben war ich in der erlebnisreichen letzten Woche nur kaum gekommen. Einen frischen Orangensaft schlürfend ging die Arbeit schnell von der Hand. Zwei Nachhilfestunden später war dann auch der Upload meiner Bilder bei 100% – vier Stunden für drei Gigabyte … schnell geht anders – und ich konnte das Internetcafé wieder verlassen. Gemeinsam mit Hans wollte ich mich nun auf dem Fischmarkt – der einzigen Sehenswürdigkeit Nouakchotts – treffen. Einmal die Hand rausgehalten, schon sitze ich in einem Fahrzeug älteren Baujahrs, dass mich für einen kleinen Betrag zum Fischmarkt bringt. Einheitliche Taxis gibt es in Nouakchott nicht – theoretisch kann alles ein Taxi sein. Auf dem Fischmarkt wird mir schnell klar, dass der Plan sich hier mit Hans zu treffen schwierig werden könne – ich habe keine mobilen Daten und die Chance das wir uns auf dem mehr als unübersichtlichen Markt finden geht gegen Null. Alleine bahne ich mir also einen Weg durch die Markthalle, welche bereits auf hunderten Metern Entfernung an ihrem modrig-fischigem Gestank zu erkennen ist. Die hunderten Hackbeile mit denen die Fischer ihren Fang verarbeiten erzeugt einen regelrechten Rhythmus in dem Verkaufsgebäude. Ich bin derweil damit beschäftigt zu hoffen, dass das bestialisch stinkende Gemisch aus Fischschuppen, -innereien, und -flossen, dass den gesamten Boden der Halle bedeckt nicht höher steigt als meine Schuhsohle es verträgt. Einmal die Fischhalle durchquert stehe ich am Strand. Unzählige farbenfroh bemalte Holzboote warten hier auf ihren Einsatz. Ein weiteres Dutzend der Bote, schwimmt auf dem Wasser. Mit vereinten Kräften ziehen Fischer ihre Boote an Land und entladen diese. Auf dem Kopf – die stinkende Soße auf den Körper tropfend – werden die fischgefüllten Plastikkisten, dann in Richtung Markthalle transportiert. Neben Müll liegen überall im Sand auch Fischreste – Baden, so wie ein paar einheimische Kinder das tun, würde ich hier nicht. Ich suche mir einen ruhigeren Ort zwischen den Holzboten etwas abseits des Trubels und warte dort auf den Sonnenuntergang. Irgendwie beeindruckt diese Szenerie, das Meer aus bunten Boten, die Unverblümtheit, die die Menschen hier an den Tag legen. Und zugleich läuft es mir kalt den Rücken runter, wenn ich mir die extreme Armut, die miserablen Arbeitsbedingungen, das unglaubliche Tierleid und die fragwürdigen Hygienestandards angucke.
Freitag 09.02.2024 – Kontraste
Das Internetcafé hatte sich gestern bewährt und so niste ich mich auf heute wieder dort ein: Ein paar neue Website-Projekte, die restlichen Bilder hochladen, Nachhilfestunden geben. Am Nachmittag treffe ich mich – diesmal wirklich – mit Hans. Während die Temperaturen heute morgen noch angenehm waren, ich den ganzen Vormittag in einem gut klimatisierten Café saß, kommt jetzt eine Wand aus 35°-heißer schwüler Luft und stehender Sonne auf mich zu. Als ich Hans treffe, stellen wir schnell fest, wie unterschiedlich wir die letzten Tage erlebt haben. Während ich in einer Villengegend nahe des Stadtzentrums gehaust hatte, war Hans bei einem Iman in einem der Randviertel untergekommen. Entsprechend erstaunt reagierte er, als wir durch eine modernere Restaurant und Caféstraße Straßen laufen. „Bei mir konntest du die letzten Tage die Mäuse und Kakerlaken zählen, wenn du überhaupt ein Restaurant gefunden hast“. Wir treffen auf einen modernen westlich wirkenden Supermarkt. Jedes Produkt einzeln aufgestapelt, breite saubere Gänge, spanische Importwaren, Raffaello-Pyramiden am Eingang – hier fühlt sich der Europäer wie zu Hause. In einem Eisladen gönnen wir uns ein Eis. Zwei Sorten stehen zur Auswahl, bei denen der künstliche Geschmack irgendwie an die Soße in einem Doppeldeckerpudding erinnert – mal eine Abwechslung. Gemeinsam geht es dann noch einmal zum Fischmarkt. Auf der Suche nach einem Restaurant finden wir einen knappen Kilometer von dem Fischmarkt entfernt ein Resort. Ein hoher Stacheldrahtzaun trennt das Gelände vom Rest der Umgebung. Eine Handvoll weiße Touristen und überraschend viele Leute, die ich der lokalen Oberschicht zuordnen würde, baden an dem müll- und fischbefreitem Strand. In dem Restaurant werden sowohl lokale als auch europäische Gerichte nach westlichen Koch- und Servicestandards serviert. „Was meinst du, wie anderes als wir jemand Mauretanien erlebt, wenn er hier ins Resort kommt und vielleicht – in einem schicken klimatisierten Geländewagen – noch einen kurzen Abstecher in eine der höherpreisigen Unterkünfte in Chinguetti macht?“ Es ist krass, diese komfortable All-Inklusive-Welt keinen Kilometer von einem der dreckigsten und ärmlichen Orte, die ich je gesehen habe zu sehen. Nach dem Sonnenuntergang heißt es: Abschied nehmen – Hans würde morgen weiter in den Senegal fahren, ich erst am Sonntag.
Samstag 10.02.2024 – Flauer Magen
Während ich normalerweise nicht länger als bis acht schlafe, muss ich mich heute auch um zehn noch aus dem Bett quälen. Mir geht es aus irgendeinem Grund alles andere als blendend. Einzig und allein der Drang auf Klo zu müssen und das Verlangen mehr zu machen als nur im Bett zu liegen bringen mich auf die Beine – Ich habe Durchfall. Immer wieder sitze ich nur da und prokrastiniere – ich bin das erste Mal auf meiner Reise so wirklich krank. Der 20-minütige Weg zum Supermarkt – ich möchte noch ein paar Dinge, Desinfektionsmittel zum Beispiel, besorgen, bevor ich morgen Westafrika betrete – wird zu einer Herausforderung. Erschöpft lasse ich mich wieder auf mein Bett fallen und verbringe dort den gesamten Vormittag. Immerhin verpasse ich in Nouakchott nicht all zu viel. Ursprünglich war es mein Plan in Richtung Senegal zu trampen, doch das könne ich so vergessen. Blöd, vor allem auch, weil das Taxi nach Saint-Louis knapp 30€ kostet und meine Reisekasse sich noch immer nicht ganz von den recht teuren letzten zwei Wochen erholt hat. Hans schickt mir derweil den Abfahrtsort für die Taxis – „Sei am Besten gegen sieben da“. Erst am Nachmittag verlasse ich mein Zimmer wieder, um mich auf den Weg ins Café zu machen und dort eine Nachhilfestunde zu geben. Enttäuschung – das WLAN geht heute nicht – anstatt mich mit einem kühlen Fruchtsaft ins klimatisierte Café zu setzten, muss ich also wieder zurück nach Hause laufen und dort hoffen, dass das Internet des Vaters stark genug ist. Zweieinhalb Stunden sitze ich im Innenhof, gebe erst eine Stunde Nachhilfe und telefoniere dann mit meiner Familie – das ist nach zwei Wochen längst überfällig. Damit mein Magen zumindest die Chance hat sich zu rehabilitieren, esse esse ich noch einmal in einem „vernünftigen“ Restaurant und beginne dann meine Sachen zu packen. Gerade als ich mich bettfertig mache, kommt Abdous Bruder und bringt mir die Wäsche, die ich ihm vor zwei Tagen überlassen habe. Mir fällt die Kinnlade runter: Aus meinen „Frisch-gewaschenen“ Klamotten bröckelt Mörtel. Worin hat man die denn gewaschen? In einem Betonmischer? Ganz ehrlich – die sah direkt nach dem Eisenerzzug besser aus. Ich rieche lieber nicht an der Wäsche – nicht das sie gar nicht gewaschen sondern nur durch den Bauschutthaufen geschleift wurde.
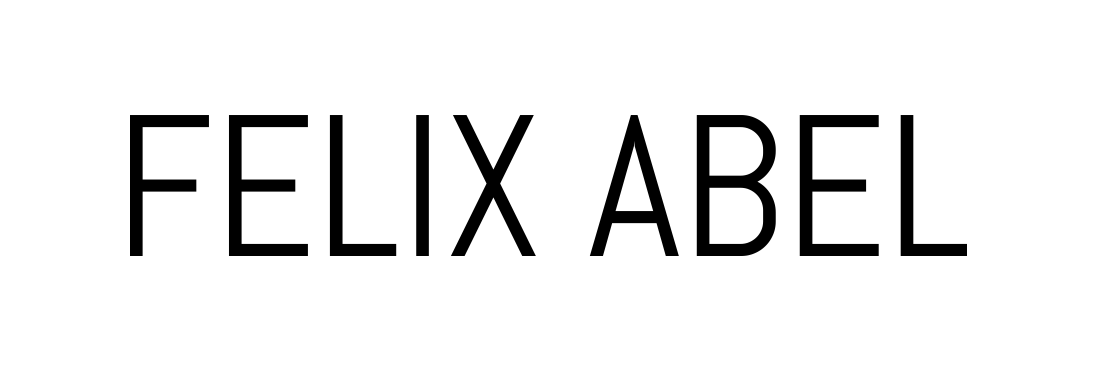



















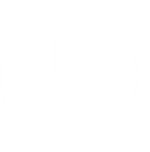


Sonntag 11.02.2024 – Kulturschock
Früh am Morgen um kurz vor fünf klingelt mein Wecker. Meinen Rucksack geschultert, mache ich mich zu Fuß – auf Taxis möchte ich mich zu dieser Zeit nicht verlassen müssen – auf dem Weg zu dem Ort, von dem die Sammeltaxis nach Saint-Louis fahren sollen. Wichtig ist mir dabei, dass das Taxi über die recht kleine Grenze in Diama und nicht über den Hauptgrenzübergang in Rosso fährt. Dieser zählt nämlich zu den korruptesten Grenzübergängen ganz Afrikas. Wer dort über die Grenze will muss schonmal ein paar – oder auch ein paar hundert – Euro Schmiergeld zahlen. Der Grenzübergang in Diama soll entspannter sein, lässt sich dafür aber nur über eine ungeteerte Schlaglochpiste entlang des Senegal-Flusses erreichen. Um sieben Uhr – nach zwei Stunde Fußmarsch durch das nächtliche Nouakchott komme ich bei dem Busunternehmen an. Mein Rucksack wird auf das Dach geschnallt und wir beginnen – nachdem sich das Fahrzeug gefüllt hat – unsere Fahrt. Nach vielen recht entspannten Kilometern auf geteerten Straßen beginnt die „Dirt Road“. Vor jedem der unzähligen Checkpoints faltet sich unser Fahrer ein Scheinchen in der Hand klein, dass dann bei dem Handschlag mit dem Polizeibeamten den Besitzer wechselt, zu einem freudigem Grinsen führt und uns die sonst üblichen Passkontrollen erspart. Wir fahren nur noch im Schritttempo und trotzdem vibriert das ganze Auto so sehr, dass man daran zweifelt ob die alte Karosserie standhält. Kurze Pause: Ein liegengebliebener LKW blockiert die Strecke. Anschieben helfen, dann geht’s weiter. Immerhin führt die dreistündige Fahrt auf der Schotterpiste durch einen Nationalpark. Die Wüste beginnt hier wieder Farben – ein seichtes Grün – und eine vertikale Ebene zu bekommen. Warzenschweine laufen am Straßenrand herum. Endlich erreichen wir Diama: Schnell, unbürokratisch und ganz ohne Schmiergeldzahlung gibt es den Ausreisestempel. Dann wird es spannend: Das gesamte Gepäck und alle Passagiere müssen nur von dem mauretanischen 8-Sitzer Toyota Avensis in einen kleinen 5-Sitzer Peugeot mit senegalesischem Kennzeichen. Zu vier auf die Rückbank gequetscht überqueren wir den Damm über den breiten Senegal-Strom, der die Grenze zwischen Mauretanien und dem Senegal bildet, bevor ich nach ein paar Fingerabdrücken und einem Foto meinen Einreisestempel in den Pass gedrückt bekomme. Die restlichen 45 Minuten geht es auf geteerten Straßen in Richtung der ehemaligen Hauptstadt Französisch-Westafrikas. Kaum habe ich die eiserne Brücke zur „Île de Saint-Louis“ überquert bietet mir schon ein Touristen-Guide seine Dienste an. Ich wechsle erstmal Geld – 9000 mauretanische Ouguiya gegen 136.000 Westafrikanische Franc – und mache mich auf die Suche nach dem günstigsten Hostel der Stadt. Kaum betrete ich das Dormitory, lächelt mich auch schon Hans an – er habe noch eine Nacht drangehängt. Auch er war gestern krank gewesen und wir kommen auf das Eis als den gemeinsamen schuldigen Nenner. Saint-Louis ist das komplette Gegenteil von Nouakchott. Während Mauretanien noch vor allem von der arabischen Welt geprägt war, wird im Senegal Westafrika so wirklich sichtbar. Graue Häuser auf staubigen Straßen werden hier durch bröckelige bunte Prachtbauten aus der Kolonialzeit, grüne Büsche und Palmen ablöst. Die Menschen tragen statt Tracht und Turban kurze Hose, T-Shirt und Basecap. Die Rufe des Iman sind durch fröhliche Jazz-Musik ersetzt worden. Ich bin final im südlich der Sahara gelegenen Westafrika angekommen. Gemeinsam mit Hans gehe ich auf den Markt. Für 700 Franc (1,07€) gibt es eine halbe Honigmelone für 1000 Franc (1,53€) eine Kokosnuss – beides selbstverständlich mundfertig zubereitet. Gelb-schwarze Taxis – so dick lackiert, dass die Farbe das Fahrzeug zusammenhält – zieren die Straßen. Wir lassen uns in einem kleinem Park am Ende der großen Brücke, die zwei der drei Inseln, auf denen Saint-Louis liegt, verbindet, auf einer Bank nieder und schauen dem Sonnenuntergang zu – weder einen öffentlichen Park, noch Sitzbänke, mal ganz zu schweigen von Mülleimern hatte es in Mauretanien gegeben. Am Abend gehen wir noch in ein Restaurant und gucken dort auf einem alten kleinen Fernseher das Finalspiel des Afrika-Cup: Nigeria gegen Elfenbeinküste.