Montag 22.04.2024 – Technische Probleme & ein Visum
Als ich am Morgen meinen Laptop hochfahre erlebe ich eine böse Überraschung. Nur 30%? Der hing doch die ganze Nacht am Strom. Ich stöpsle den Laptop also einmal ab hänge ihn wieder die Powerbank. Doch anstatt das diese den Laptop lädt blinkt sie nur einmal kurz auf und geht dann wieder aus. Mist! Ich probiere sämtliche Kabel und Geräte durch, doch es bleibt dabei – obwohl die Powerbank 100% anzeigt, lädt sie keines meiner Geräte. Mein Laptop lässt sich hier in Afrika nur über die Powerbank laden – das Stromnetz hat nicht genug Leistung. Ich lade jedes Mal die Powerbank auf, die dann mit voller leistung den Laptop lädt. Ohne funktionstüchtige Powerbank ist mein Laptop also wertlos. Mein Kopf verfällt in Panik: Was hat das für Auswirkungen? Unabhängig davon müsste ich nun erst einmal ins Stadtzentrum zur Botschaft der Elfenbeinküste fahren und mein Visum beantragen – Laptop hin oder her. Ich nehme mir also ein Mototaxi und lasse mich an die Spitze der Landzunge, auf der Conakry liegt bringen – eine Stunde für sechszehn Kilometer. In der Botschaft wartet neben mir noch ein Fahrradfahrer, der ebenfalls auf dem Weg nach Süden ist und ein Visum braucht. Schell ist das Antragsformular ausgefüllt und man sagt uns – zu meiner Überraschung – das wir unsere Visa schon heute Nachmittag abholen könnten. Ich schlage also etwas Zeit in der Innenstadt tot. Die Armut stapelt sich hier auf mehreren Etagen. Ärmliche Wellblechhütten, auf deren Dächern gerade eine Ladung Wäsche trocknet spiegeln sich in den gläsernen Fassaden moderner Konzernzentralen. Arm und reich leben hier Tür an Tür aneinander. Ich finde ein kleines Restaurant in dem ich die vier Stunden, bis ich mein Visum abholen können soll, absitze. Ein Klimaanlage, Steckdosen – sogar mit Strom – WLAN und ein Nutella-Crêpe befriedigen derweil alle meine Bedürfnisse und lassen die Wartezeit schnell vergehen. Um halb drei stehe ich wieder in der Botschaft. Mein Visum soll ich offiziell erst in eineinhalb Stunden abholen könnt und so wundert mich es nicht, dass dieses noch nicht fertig ist. Ein wartender Felix bringt allerdings Elan in die Botschaft: Schon zwanzig Minuten später überreicht man mir meinen Reisepass mit eingeklebten Visum. Der Rückweg soll noch einmal länger dauern als der Hinweg. Entweder mein Fahrer hat seinen Führerschein gerade erst bekommen oder er ist neu in dem Business. Im Schneckentempo tuckern wir eine kleine Straße nach der anderen entlang bevor wir nach anderthalb Stunden, tatsächlich dort ankommen wo ich hinwill. Adre habe ich den ganzen Tag noch nicht gesehen, auf Nachrichten reagiert er auch nicht, meine Powerbank weigert sich weiterhin irgendwelche Geräte zu laden. Am Handy gebe ich zwei Nachhilfestunden – das ist zwar nervig aber geht irgendwie. Gerade als ich mit der zweiten Nachhilfestunde durch bin taucht Abdre auf – Er habe seit gestern Morgen geschlafen. Gemeinsam fahren wir noch einmal zu der Shopping-Mall, in der ich erfolglos nach einer genug Leistung bietenden Ersatzpowerbank suche, bevor wir uns dann noch ein Bier holen und unseren letzten gemeinsamen Abend auf Abdres Terrasse ausklingen lassen. Hoffungsvoll stecke ich bevor ich ins Bett gehe meinen Laptop an die Steckdose – die Hoffnung stirbt zuletzt.
Dienstag 23.04.2024 – Straße des Todes
Auch am heutigen Morgen werde ich wieder bitter enttäuscht: Der Laptop ist nach wie vor leer – so leer, dass er nicht einmal mehr das „Batterie leer“-Logo anzeigen kann. Nützt nichts, ich packe dennoch meine Sachen. Abdre ist – ich glaube es kaum – pünktlich fertig und bringt mich zum Gare Routiere. Mein nächstes Ziel ist das Inland von Guinea. Nicht weit von einander entfernt gibt es dort einige Sehenswerte Orte, doch dafür muss ich erstmal 350 Straßenkilometer zurücklegen. Die Straße von Conakry nach Mamou ist eine der am besten ausgebauten im ganzen Land. Eine angenehme oder gar schnelle Fahrt wird es trotzdem nicht geben. Zu aller erst müssen wir aus Conakry raus – allein das dauert in dem dichten Verkehr eine ganze Stunde. Während wir die Stadt verlassen stelle ich fest, wie wenig ich eigentlich von Conakry gesehen habe. Dazu wird mir klar, dass es außerhalb von Conakry ein Ding der Unmöglichkeit werden würde eine geeignete Powerbank oder einen Laptopersatz – inzwischen denke ich darüber nach mir ersatzweise ein günstiges Android Tablet zu kaufen – zu finden. Und bis zur nächsten Hauptstadt wäre es noch ein langer Weg. Ich bereue meine Abreise – aber es ist zu spät. Auf einer schön geteerten Straße fahren wir immer weiter ins bergige Inland. Wir kommen recht zügig voran – anders als die unzähligen LKW die die kurvigen Straße nur entlangkriechen können. In Folge dessen kommt es quasi minütlich zu riskanten Überholmanövern. Das meine Angst vor diesen berechtigt ist, verdeutlichen mir hunderte Frontalcrashschäden aufweisende Fahrzeugwracks am Straßenrand – Im Schnitt alle hundert Meter liegen die vollkommen zertrümmerten Karosseriereste links und rechts der Straße. Mal ist nur noch ein rostiges auseinander geflextes Fahrgestell übrig, mal lässt das noch auf dem Dach festgezurrte Gepäck darauf schließen, dass der Unfall erst einige Stunden – höchstens ein paar Tage – alt ist. Apropos Gepäck: Der Gepäckberg auf jedem Auto ist mindestens genau so hoch, wie das Auto selbst. Nicht selten sitzen oben auf diesem Gepäckberg dann nochmal eine Handvoll weitere Passagiere. Zum Mittag halten wir in einem kleinen Dorf – immerhin scheint das Mittagsessen aus der gemeinsamen Schüssel inklusive zu sein. Es folgen weitere drei Stunden Fahrt, bis wir gegen Abend in Dalaba ankommen. Neben einer alten Hausruine bau ich auf einem kleinen Hügel in der Stadt mein Zelt auf, schon ist es dunkel. Im Zelt grüble ich noch einmal nach den verschiedenen Möglichkeiten, die ich habe um meinen Laptop Ausfall zu beheben. Eine genug Leistung bringende Powerbank oder gar ein originales Surface-Ladegerät finden? Unmöglich. Nach Conakry zurückkehren und dort ein günstiges Tablet als kaufen? Dann müsste ich noch einmal diese Horrorstraße längsfahren und knappe 200€ für ein Gerät ausgeben, dass ich eigentlich nicht haben will. Warten bis ich in der Elfenbeinküste bin? Aber was ändert das? Die Optionen werden dort auch nicht mehr werden. Und kann ich überhaupt so lange ohne meinen Laptop auskommen? Wie lange machen meine Nachhilfeschüler einen Lehrer, der nichts aufschrieben oder zeichnen kann, mit? Was passiert mit meinem Blog? Die einzige sinnvolle Lösung scheint es mir am Ende zu sein mein originales Ladegerät aus Deutschland in die Elfenbeinküste schicken zu lassen und mich dann so schnell wie möglich auf den Weg dorthin zu machen – doch selbst das würde knappe zwei Wochen ohne Laptop bedeuten. Das mag für den Einen gar nicht so schlimm klingen, doch wenn man sein Geld mit diesem Laptop verdient, dann ist das eine Totalkatastrophe.
Mittwoch 24.04.2024 – Zauberer, Götter und Fetischpriester
In Dalaba gibt es eigentlich nur eine Sehenswürdigkeit: Die Casa a Palabre. Etwas außerhalb der Stadt gelegen sollen sich in diesem sagenumwobenen Gebäude einmal die führenden Zauberer und Fetischpriester Guineas getroffen haben. Auf meinen Weg dorthin lasse ich mich aber erstmal vor einem Krämerladen nieder und frühstücke. Mein schmales Frühstück aus einem Nutella-Baguette wird von frischen Mangos ergänzt, die ich geschenkt bekomme. Nach ein paar hundert Metern erreiche ich ein von außen unscheinbar wirkendes rundes Gebäude: Das soll sie also sein – die Casa a Palabre. Ein mittelmäßig motivierter junger Mann schließt mir die hölzerne Tür auf. Im inneren ist der runde Saal mit unzähligen mandalaartigen Motiven versehen. Der gesamte Boden, die Wände und auch die Decke sind kunstvoll verziert. Man erklärt mir dass diese Verzierungen natürlich auch einen tieferen Sinn und jede eine eigene Bedeutung hätten – mir reicht allerdings der beeindruckende Anblick. Da es noch früh am morgen ist, beschließe ich mich noch auf den Weg zu einer weiteren Sehenswürdigkeit zu machen – dem Pont du Dieu. Knappe 10 Kilometer außerhalb von Dalaba soll ein natürlicher Steinbogen einen kleinen Wasserfall überspannen. Zu Fuß mache ich mich auf den Weg, der mich durch beeindruckende schattige Pinienwälder, kleine von Hand bewirtschaftete Felder und über provisorische Brücken führt. Schweißdurchtränkt erreiche ich dann den kleinen Wasserfall, der jetzt am Ende der Regenzeit kaum Wasser führt. Dennoch ist die „von Gott geschaffene Brücke“ schön anzusehen und der Wasserpegel in dem darunterliegenden Becken reicht für eine kühle Erfrischung. Für den Rückweg schlägt mir mein Handy eine kürzere Route vor – allerdings mit wesentlich mehr Steigung. Entlang kleiner Dörfer quäle ich mich die Berge hoch und runter. Die Sonne steht hoch am Himmel, die Last meines Rucksacks drückt auf meine Schultern. Vollkommen fertig komme ich an der am Rande Dalabas gelegenen Tankstelle an, die ich als Ziel eingegeben habe. Warum eine Tankstelle? Der kleine Tankstellenshop bietet eine – wenn auch überteuerte – Auswahl westlicher Carefour-Produkte an. Ich gönne mir einen Jogurt – Milchprodukte bekommt man hier nämlich sonst nicht. Bei bezahlen stelle ich fest, dass meine Bargeldreserven ziemlich knapp geworden sind. Ein Tankstellenmitarbeiter erzählt mir, dass es hier keinen Geldautomaten gäbe, aber ich um die große Moschee herum vielleicht jemanden finden könnte, der genug Geld hat um mir ein paar Euros zu wechseln. Tatsächlich lässt sich der Besitzer eines Baugeschäftes auf mein Angebot ein und wechselt mir zu einem guten Kurs, die drei Zwanzig-Euro-Scheine, die ich noch aus Deutschland in meinem Portemonnaie habe, zu einer halben Million Guinea Franc. Mit dem Handy setzte ich mich dann an eine Mauer nahe des Funkmasts und gebe drei Nachhilfestunden. Als ich nach der letzten Nachhilfestunde die Kopfhörer aus meinen Ohren nehme kommt der Schock – Wo ist mein AirPods Case? Während der Stunden war ich immer weiter Richtung Funkmast gelaufen um besseres Signal zu bekommen und nun fehlte mir die kleine Ladeschatulle. Ein paar Kinder die mich suchen sehen, können mir glücklicherweise weiterhelfen. Ein kleines Mädchen hat mein Kopfhörer-Case gefunden und läuft nun damit weg. Zwanzig Minuten laufe ich also mit einer Horde von Kindern um mich dem Mädchen hinterher, bis wir an deren Haus ankommen und mir die Mutter bereits mit meinem Case entgegenkommt. Puh! Nochmal Glück gehabt. Mein Zelt habe ich für heute Nacht neben der Casa a Palabre aufgebaut, denn ich brauche Strom. Spaßeshalber stecke ich, als ich eh gerade die Kabel rauskrame meinen Laptop an die Powerbank und werde überrascht. In dem Moment, in dem ich erwarte, dass die Powerbank nun einfach ausgeht wechselt die kleine LED-Anzeige von einer 100 auf eine 99 – Zehn Minuten Später ist es schon eine 86. Die gesamten letzten Tage hatte ich gebetet, dass dieses Problem sich genau so plötzlich, wie es gekommen ist einfach wieder löst, die Powerbank wieder das tut was sie soll. Mir kommen Tränen in den Augen … was für einen großen Gott wir doch haben! Als ich ins Bett krieche ist der Laptop voll geladen, obendrauf schickt mein Vater mir ein Bild von einem Express-Paket, dass mein Netzteil nun nach Afrika befördern würde.
Donnerstag 25.04.2024 – Kambadaga-Falls
Gemütlich mache ich mich am nächsten Morgen auf den Weg Richtung Gare Routière. An einem kleinen schattigen Plätzchen neben dem Funkmast mache ich Pause und fahre freudestrahlend meinen Laptop hoch und stelle den letzten Blog-Beitrag online – der ist schon seit dem letzten Sonntag fertig. Am Gare Routière muss ich eine Stunde warten. Pita, mein nächstes Ziel ist, ist nur 50 Kilometer entfernt und dennoch scheint es wenig Interessenten zu geben, die dort hinwollen. Irgendwann wird umdisponiert: Unser Auto würde heute nicht mehr voll werden. Ich und ein anderer Fahrgast steigen gegen einen erhörten Fahrpreis in ein anderes Buschtaxi, dass uns in Pita rauslassen kann. Anderthalb Stunden brauchen wir auf den grausamen Straßen für die 50 Kilometer. Den Fahrersitz teile ich mir mit einer Frau. Ob es Studien gibt, die die Anzahl an Thrombosen und Bandscheibenvorfällen in Bezug zu Buschtaxifahrten auswerten? Als ich nach einer halben Stunde mein eigequetschtes Bein nicht mehr spüre, rückt die Dame auf die Mittelkonsole. Ich spüre wie langsam wieder Blut in mein Bein fließt, dafür muss unser der Frau nun bei Schalten jedes Mal zwischen die Beine greifen – aber das scheint für niemanden ein Problem zu sein. In Pita angekommen esse ich etwas, kaufe ein bisschen ein und organisiere mir dann ein Mototaxi, dass mich zu den dreißig Kilometer entfernten Kambadaga-Wasserfällen bringen soll. Nach harten Verhandlungen einigen wir uns auf einen Preis von 60.000 GNF (6,56€). Der Weg ist extrem schlecht, das sagen sogar die Einheimischen – und das will was heißen. Nach einer Stunde werde ich an einem Fluss abgesetzt. Ich laufe als erstes zum Pont des Lianes. Die rustikale Hängebrücke hat allerdings schon bessere Zeiten gesehen – ich bleibe also auf meiner Uferseite. Ein schmaler zugewucherter Pfad führt steil in die Tiefe. Vorsichtig klettere ich herunter. Immer wieder gerate ich ins Rutschen festhalten ist auch keine Option – die Stämme der Bäume haben großen Stacheln. Irgendwann muss ich meinen Rucksack absetzen und hinterherschleifen um überhaupt noch eine Chance zu haben vorwärts zu kommen. Doch der kräftezehrende Weg lohnt sich. Ich komme auf einem kleinem Plateau zischen den beiden Wasserfällen aus dem Dickicht. Zu meiner linken stürzt das Wasser in die Tiefe zu meiner rechten befindet sich das untere Ende eines weiteren Wasserfalls. Alles ist grün, weit und breit nur Dschungel. Nicht ein Mensch, keine Absperrungen oder Hinweisschilder, einfach nur Natur. Auch am Ende der Regenzeit sind die beiden riesigen Wasserfälle noch unglaublich beeindruckend. Einfach nur wow! Kein Foto kann annähernd das Gefühl beschrieben dort zu stehen. Durch das knietiefe Wasser warte ich in Richtung des Beckens vor dem unteren Wasserfall und gehe eine Runde schwimmen. Auf dem Rückweg kommen mir zwei in Männer entgegen. Sie seien die Beauftragten für den Wasserfall erklären sie mir – ich müsse 50.000 Franc (5,47€) Eintritt zahlen. Allerdings weiß ich, bereits von anderen Berichten, dass es sich dabei lediglich um einen Scam handelt. Wofür die Gebühr denn wäre möchte ich wissen. Man deutet auf die offensichtlich in selbst erstellten „Rangerausweise“ auf denen Bilder der Straße, der Hängebücke und des Wasserfalls zu sehen sind – das halte man alles instand. Ich entgegne, dass die Straße die schlechteste sei, der ich in ganz Afrika begegnet sei, die Hängebrücke ist kaputt und der Wasserfall … der ist ja wohl von Natur aus so. Doch man bleibt dabei, dass man hart arbeite – schon Montag würde die Brücke repariert werden. Um sein Wohlwollen an der Natur zu verdeutlichen wirft der eine Ranger dann seine Zigarette in den Fluss – dass das mittelmäßig überzeugend ist, sieht er wenig später selbst ein. Ein Ticket – das gibt es selbst hier eigentlich bei jeder Sehenswürdigkeit – kann man mir nicht geben und offizielle Ausweise – nicht die selbstgebastelten Rangerausweise ohne Namen drauf – will, oder kann, man mir auch nicht zeigen. Nach einer halben Stunde Diskussion heißt es dann nur noch „Bezahl oder nimm deinen Rucksack und verschwinde.“ Ich nehme also meinen Rucksack, hole gemütlich ein Stück Brot und Schokocreme daraus, setzte mich hin und beginne zu essen. Die beiden Möchtegern-Ranger haben allerdings Ausdauer: Eine Stunde lang wiederholt man im fünf Takt die Aussage „Bezahl oder nimm deinen Rucksack und verschwinde!“ Nach langem Überlegen zahle ich tatsächlich zumindest einen Teil des Preises – nicht weil ich Glauben an ihren Geschichten gefunden habe, sondern weil ich die Zeit hier genießen und mich nicht von zwei Deppen Nerven lassen möchte. Wo die beiden schonmal da sind kann man sie aber zumindest auch ausnutzen – ich rekrutiere einen der beiden noch zum Fotografen, bevor sie dann endlich verschwinden. Stück für Stück quäle ich mich den schmalen Trampelpfad zum Weg wieder noch oben, um diesen dann noch weitere zwei Kilometer entlang zu laufen. Im Busch über den Wasserfällen thronend hat man von hier einen atemberaubenden Blick über die beiden Wasserfälle. Auch hier: Kein Geländer, keine Schilder, kein einziger anderer Tourist. Als die Sonne Stück für Stück hinter dem Horizont verschwindet laufe ich wieder bergab, gehe nochmal eine Runde schwimmen und schlage kurz hinter der Hängebrücke mein Zelt am Flussrand auf.
Freitag 26.04.2024 – Ungewollte Wanderung
Nachdem ich die morgendliche Ruhe am Wasserfall genossen habe, rufe ich den Möchtegern-Guide von gestern an – er hatte mir angeboten, mich auf dem Motorrad zurückzubringen, denn wo keine Menschen sind, sind auch keine Mototaxis und ich habe nicht wirklich vor die sechszehn Kilometer zu meinem nächsten Ziel zu Fuß zurückzulegen. Der Guide kommt und es geht an die Preisverhandlungen: 250.000 Franc (27,34€) möchte er für die 24 Straßenkilometer nach Doucki haben – die Straße sei schlecht. Ich bleibe allerdings hart: Ich zahle maximal 100.000 Franc (10,94€) – wenn man bedenkt dass ich vor einer Woche für 30.000 Franc (3,28€) dreißig Kilometer Mototaxi gefahren bin, ist selbst das in meinem Augen schon ziemlich hochgegriffen. Mürrisch lässt er sich auf meinen Preis ein und düst los. Wir sind keinen Kilometer weit gekommen, da ist der Reifen platt. Mein Fahrer ist wütend, ich ebenfalls. Wenn man nicht querfeldein durchs Gestrüpp, sondern auf dem Weg gefahren wäre, wäre das vielleicht nicht passiert – aber das will man nicht hören. Den „Weg“ auf dem wir nun stehen, kennt nicht mal eine meiner drei Navigationsapps. Eine halbe Stunde laufe ich gemeinsam mit meinem Fahrer durch Niemandsland, bis wir irgendwann wieder auf einen offiziellen Weg treffen. Hier trennen sich unsere Wege. Ich drücke dem Jungen noch 40.000 (4,37€) Franc in die Hand, aber wie bei jedem Preis nörgelt er – er wolle 70.000 (7,65€) haben, schließlich sei die Reparatur seines Mopeds teuer. Pfff! Das sei wohl kaum mein Problem. Der gute Mann hat mich einen Kilometer gefahren – weg von jeglichen Wegen. Dafür dass ich nun genausoweit laufen muss, wie wenn ich vom Wasserfall gelaufen wäre, finde ich 40.000 Franc schon fast zu großzügig. Ich laufe ungeachtet seines gezetertes weiter. Die Hitze drückt, mein Weg – nur ein kleiner Trampelfahrt – führt immer wieder durch winzige abgelegene Dörfer, der schwere Rucksack schmerzt an den Schultern. Ja, wandern ist der Grund warum ich nach Doucki möchte, aber so war das nicht geplant. Das einzig schöne sind die Mangos, die hier überall auf dem Weg wachsen – so viele, dass die meisten am Boden vergammeln, weil niemand sie alle essen kann. Ich mache also alle zwanzig Minuten Pause und gönne mir ein paar der süßen Früchte. Nach drei Stunden Fußmarsch in der Mittagssonne erreiche ich ein Dorf mit Straßenzugang. Erschöpft lasse ich mich vor einem Tante-Emma-Laden auf die Bank fallen und kaufe den gesamten gekühlten Sprite-Vorrat leer. Für die Kinder bin ich währenddessen das Highlight – knapp 20 Kinder gucken mir gespannt beim Trinken zu. Noch neun Kilometer sind es bis zu meinem Ziel – jetzt gibt’s aber ein Mototaxi. Zwanzigtausend – da muss ich nicht mal mehr handeln – eine Bestätigung, dass nicht meine, sondern die Preisvorstellungen des Möchtegern-Rangers hochgegriffen waren. Eine Viertelstunde später stehe ich in Doucki vor dem Tor von Hassans Unterkunft. Der Ruf des hier am Rande des Fouta-Djallon-Gebirge, der Seele Guineas, lebenden bekennenden Kapitalisten, der hier ein Monopol für Wandertouren unterhält, eilt ihm voraus. Für 50€ pro Tag – inklusive Unterkunft, Essen und einer Wanderung täglich – bietet der 62-jährige Wandertouren durch die umliegenden Schluchten an. Auf Onlineplattform ließt man folgende Sätze über seinen Charakter. „If you don’t have the money, stay away from him. He doesn’t likes people without money”. Da mir allerdings unzählige Menschen seine Wandertouren empfohlen hatten, hatte ich ihn trotzdem kontaktiert und ihm geschrieben, dass ich Low-Budget unterwegs bin und gefragt, ob es die Möglichkeit gäbe nur die Wanderungen zu machen – den Rest würde ich selber organisieren. Die Antwort darauf war „Menschen sind wichtiger als Geld – sag mir dein Budget“. Nachdem ich ihm dieses genannt hatte bekam ich trotz vieler weiterer Nachfragen aber keine Antwort mehr – vielleicht doch zu wenig Geld. An seiner Unterkunft angekommen, bittet man mich zu warten – Hassan sei gerade unterwegs. Ich laufe eine Runde durchs Dorf, suche schonmal nach möglichen Zeltplätzen und Wanderrouten, für den nicht unwahrscheinlichen Fall, dass Hassan mein Angebot nicht gefällt. Doch ich soll Überrascht werden: Hassan lässt sich auf mein Angebot ein, sogar mehr als das. „Wenn du bei mir Gast bist, mache ich keine Unterschiede“ – Ich bekomme den vollen Service: Ein eigenes Zimmer, Essen und Wandertouren. Zahlen solle ich einfach so viel, wie es mein Budget verträgt. Ein Grund für diese wohlgesinnte Preisgestaltung, ist mein Alter: Er sei mehr als dreimal so alt wie ich und ich wäre jünger als sein Sohn – von dem würde er schließlich auch keine 50€ verlangen können. Noch am Abend schickt Hassan mich mit einem seiner Kinder auf den Indiana-Jones Trail. Mit schneller Schritt läuft mir ein Badelatschen tragender Junge voraus und führt mich quer durchs Unterholz zu einer Schlucht in der eine Vielzahl gigantischer Felsnadeln zum herumklettern einladen. Als wir wieder zurückkommen, gibt Hassan dem Jungen direkt eine Ansage – Er sei zu schnell gewesen. Am Abend gibt es Bratkartoffeln mit gekochten Eiern. Lecker und sättigend – und doch verstehe ich die Menschen, denen das für den steilen Preis zu wenig ist: Die Räume haben keine Klimaanlage, Toiletten spülen sich nur mithilfe eines Eimers, die Matratzen sind steinhart und die servierten Getränke warm. Hassans Unterkunft ist der „Tourismushotspot“ im Landesinneren Guineas – 100 Gäste habe er dieses Jahr schon beherbergt. Und dennoch ist touristische Potenzial, dass diese Region bietet bei weitem noch nicht ausgereizt.
Samstag 27.04.2024 – Hyänenfelsen
Zum Frühstück gibt es Omelett – so gut gefrühstückt habe ich seit Wochen nicht mehr. Nach dem Frühstück suche ich mir eine Wanderung für den Tag aus. Etwa 10 Routen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und Schwerpunkten bietet Hassan an. Jede der Touren ist verlockend, die Bilder atemberaubend und doch würde ich schon nach der heutigen Wanderung wieder abreisen – zu lange will ich Hassans gnädige Preisgestaltung nicht herausfordern. Ich entscheide mich für eine Wanderung zum „Hyänenfelsen“, begleiten tut mich diesmal Hassan persönlich. Nachdem wir eine Kilometer durch dichtes Gestrüpp gelaufen sind kommen wir an einem Abhang. Vor uns erstreckt sich ein riesiges grünes Tal aus dem heraus ein beeindruckender zerklüfteter Felsen in die Höhe ragt – wow. Wir steigen den Abhang hinunter, Hassan zeigt mir in den Felsen verschiedene Figuren: Hier sieht der Felsen aus wie ein Elefant, dort wie ein Gorilla. Hassan nimmt die Tour mit mir zum Anlass ein kleines Werbevideo zu drehen. In der Ferne hört man die Schreie von Baboon-Affen, später sehen wir sogar die Silhouetten auf einem Felsen. Ab und zu frage ich mich, ob Hassan gerade einen neuen Weg erkundet – selbst mit einem GPS-Track der Route würde ich die quer durch das Gestrüpp führenden Wege nicht als solche erkennen. Hassans deutscher Wortschatz aus den Wörtern „Achtung Dornen!“ findet fleißig Verwendung. Immer tiefer geht es in die Schlucht hinein, bis wir an unterstem Punkt vor einem Wasserfall stehen. Nach einem kurzen Erfrischungsbad kommt dann der anstrengende und weniger schöne Teil der Tour – wir müssen jeden Meter den wir heruntergegangen sind wieder nach oben. Das Ziel unserer Tour ist der Marktplatz auf dem bereits gestern meine ungewollte Wanderung beendet hatte. Hier wartet auch schon mein Rucksack auf mich, den Hassan heute morgen einem vorbeifahrenden Fahrzeug mitgegeben hatte. Im Nullkommanichts hat Hassan mir ein Buschtaxi nach Pita organsiert und tischt mir in einem kleinen Restaurant eine Mahlzeit aus. Die Straße nach Pita ist besser als erwartet – nur eine anstatt der angekündigten drei Stunden brauchen wir für die 30 Kilometer lange Strecke. Erst kurz vor Pita tauchen in der Schotterpiste, die man hier Nationalstraße nennt wieder Teerfragmente aus. In Pita suche ich mir ein Buschtaxi das mich nach Mamou bringen soll. Von dort aus wären es dann noch drei Tagesfahrten bis an die Grenze der Elfenbeinküste. Unser Taxi ist allerdings mehr als langsam. Allein drei Stunden brauchen wir für die 50km nach Dalaba. Für jedes Schlagloch – und davon gibt es viele – muss gebremst werden, unsere durchschnittliche Reisegeschwindigkeit liegt bei etwas 20 km/h. Kurz nach der Stadt gibt dann das Auto seinen Geist auf. Immerhin bleiben wir unter einem Mangobaum stehen – das macht die halbstündige Zwangspause ganz erträglich. Inzwischen ist es dunkel, die Straße wir allmählich besser, wir müssen nicht mehr alle 50 sondern nun alle 200 Meter für ein straßenbreites Schlagloch bremsen. Die ersten Häuser von Mamou erscheinen schon am Straßenrand, da fällt unser Motor wieder aus. Wie lange es diesmal dauert? Man weiß es nicht. Ich nehme mir ein Mototaxi, dass mich die letzten sechs Kilometer zu meiner Unterkunft bringt. Dort angekommen erlebe ich eine Überraschung: Anstatt des erwarteten Hotels, stehe ich vor einem Nachtclub. Ich beschließe dennoch zu fragen, ob ich hier nicht zelten könne und bekomme umgehend einen Zeltplatz auf der geschlossenen Terrasse neben dem Pool zugewiesen. Sicherlich, es gibt an einem Samstagabend ruhigere Orte zum Zelten als eine Diskothek, doch bei laufendem Betrieb inmitten dieser direkt neben dem Pool zu zelten, das ist ein einmaliges Erlebnis.
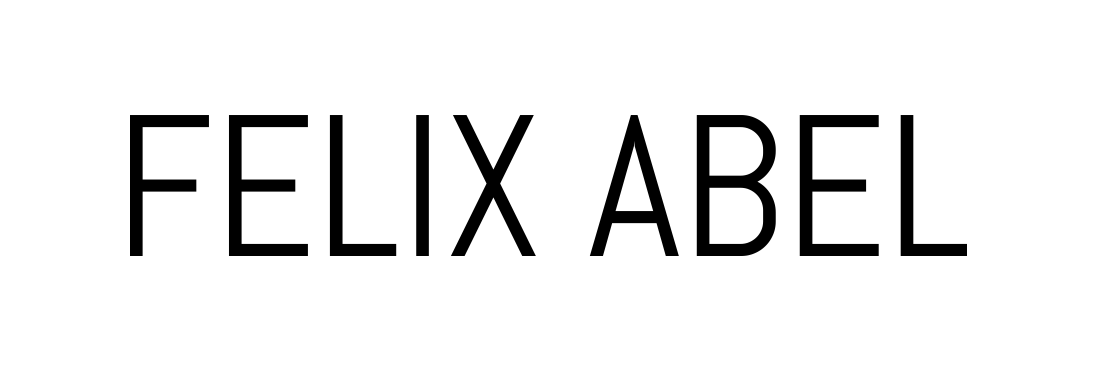









































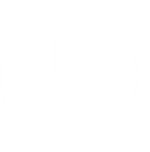


Sonntag 28.04.2024 – Der erste Regen
Früh am Morgen verlasse ich die Diskothek und mache mich auf die Suche nach dem Gare Routiere. Vorher muss ich allerdings noch ein letztes Mal Guinea-Franc abheben, was sich als schwieriger als gedacht herausstellt. Zwei Geldautomaten sind außer Betrieb, der Dritte verlang eine Gebühr von 7€ bei einer maximalen Abhebesumme von umgerechnet etwa 65€ – aber was soll‘s? Punktlicht um acht lasse ich Mamou auf die Rückbank eines Sept-Place-Taxis gequetscht hinter mir. Mein Tagesziel ist das knapp 200 Kilometer entfernte Faranah. Die Straßen sind südlich von Mamou wesentlich besser als noch gestern und wir kommen gut voran. Auf einmal beginnt es zu regnen. Erst nur ein paar Tropfen, dann so viel, das wir anhalten und eine Plane über das Gepäck ziehen müssen. Die Fester werden hochgekurbelt, der zu meiner Überraschung funktionierende Scheibenwischer zieht monoton von über die Scheibe. Seit Chefchaouen Anfang Januar ist es für mich der erste Regen hier in Afrika. Während wir langsam vorantuckern, frage ich mich was der Beginn der Regenzeit für Auswirkungen haben würde? War‘s das jetzt mit dem Zelten? Wird weiterhin der Großteil meines Lebens draußen stattfinden? Komme ich weiter so problemlos voran? Nach drei Stunden endet in einem sechzig Kilometer von Faranah entfernten Vorort. Und jetzt? Mein Taxifahrer übergibt mich einem der herumstehenden Busse – der bringt dich nach Faranah. Der Fahrer erklärt mir das er erst um 16.00 Uhr in Faranah ankommen wolle? Oder hier losfahre? Ganz sicher ist er sich nicht. Ich setzte mich hinten in den Kastenwagen, packe meinen Laptop aus und nutzte die Wartezeit sinnvoll um an meinem Blog zu schreiben. Als mir nach einer Stunde das halbe Dorf dabei zuguckt, klappe ich den Laptop dann allerdings wieder zu. Von dem morgendlichen Regen ist inzischen nichts mehr zu spüren, die Sonne knallt unerbittlich, im Inneren des Autos sind knappe 40 Grad, der Schweiß läuft mir aus allen Poren – und noch immer sind es knappe drei Stunden bis wir abfahren sollen. Warum bin ich eigentlich so früh aufgestanden? Ich lasse mir mein Geld zurückgeben und laufe an die Nationalstraße. Mit ausgestrecktem Daumen erhoffe ich mir hier einen in einem zügigeren Buschtaxi zu finden. Direkt das erste Auto hält an. Anstelle eines Buschtaxi Fahrers steigen allerdings zwei Polizisten aus. Ich ahne erst Böses, werde dann aber positiv überrascht. Klar würde man mich mitnehmen, man sei auf dem Weg nach Kissidougou – dem Ort den ich erst morgen zu erreichen erhofft hatte. Die Fahrt in dem klimatisierten Kleinwagen ist tausendmal angenehmer als die in dem abgewrackten Buschtaxi. Die beiden Polizisten erklären mir das sie Teil einer Sicherheits- und Stabilisierungsmisson der UN seinen. Nach zwei Zwischenstopps, bei denen man mich zum Essen eingeladen erreichen wir gegen acht Kissidougou. Man könne mich zu einem Hotel bringen, oder ich könne mit zu ihrer Familie kommen – die Einladung nehme ich an. Wir halten also erst bei der Großfamilie im Stadtzentrum und fahren dann zu dem am Stadtrand wohnenden Bruder des einen Polizisten. Hinter einem großen Tor, versteckt sich hier ein großzügiges Haus. Den Eingang zieren goldene Säulen – es scheint dem Mann nicht schlecht zu gehen. Ein Generator sorgt für Strom. In einem Raum, darf ich meine Isomatte aufblasen und falle dann müde ins Bett.