Montag 21.04.2025 – Schildkröten-Strand
Nachdem mich die „Covigne River George“, durch die Ich mit Stefan, Lea und Tim gewandert war, so begeistert hatte, wollte Ich diese meiner Familie keinesfalls vorenthalten. Nach einem kurzen Frühstück machen wir uns also auf den Weg zu der Schlucht und klettern durch den Dschungel. Als wir zurück am Auto sind, ist es bereits recht mittags. Auf dem Rückweg halten wir noch auf einen „Javaship Frappuchino“ bei Starbucks, bevor wir zum AirBnB fahren und uns die Reste der Pizza von gestern Abend einverleiben. Am späten Nachmittag machen wir uns auf den Weg zum Matura Beach. An dem Strand im Nordosten Trinidads sollen jeden Abend riesige Lederschildkröten zur Eiablage an Land kommen. Ursprünglich hatten wir eine Tour buchen wollen, doch der Anbieter ging weder ans Telefon noch reagierte Er auf Mails. Wir versuchen es also auf gut Glück bei Touroffice, wo man uns anbietet, dass wir spontan zu der gleich losfahrenden Gruppe hinzustoßen könnten. Durch einen dunklen Wald hindurch fahren wir zu einer kleinen Hütte am Strand – dort heißt es dann erst einmal: Warten. Nach einer Stunde kommt dann eine Mitarbeiterin der NGO – man habe eine Lederschildkröte ausfindig gemacht. Im Dunkeln stapft also die gesamte Touristenmeute der Mitarbeiterin hinterher zu dem Strand, an welchem es von Moskitos nur so wimmelt. Dort liegt sie dann – eine locker anderthalb Meter große Lederschildkröte – und buddelt mit ihren Hinterflossen schnaufend ein Loch in dem Sand. Den ganzen Abend lang beobachten wir die Schildkröte bei ihrer Eiablage. Als wir zu dem Parkplatz zurückkehren, ist es bereits spät am Abend. Zügig machen wir uns auf den Rückweg, um ins Bett zu kommen – morgen geht es wieder früh raus!
Dienstag 22.04.2025 – Touri-Programm
Trotz der kurzen Nacht geht es heute ein weiteres Mal früh los: Wir wollten einige Attraktionen besuchen, die sich ganz am anderen Ende von Trinidad befanden. Nach anderthalb Stunden Autofahrt erreichen wir unser erstes Ziel: Der „Pitch Lake“ in „La Brea“ ist eine von nur drei natürlichen Asphalt-Ansammlungen an der Erdoberfläche. Die zähflüssige Teerfläche ist hart genug, um darauf herumzulaufen und zugleich weich genug, um sie mit der Hand verformen zu können. Mit jedem Schritt, den wir über den See wandern platzen unter unseren Füßen kleine Blasen, die ein nach flauen Eiern riechendes Gas freisetzen. Nachdem wir die surreale Touristenattraktion abgehakt haben, machen wir uns auf den Weg zur nächsten – einem „Mud Vulcano“. Nur 30 Kilometer zeigt mein Navi an, erwähnt allerdings nicht, dass dies der Weg quer durch ein Ölfeld und nicht entlang der Hauptstraße wäre. Die Straßen werden immer schlechter, die Schlaglöcher tiefer – ein anderes Auto haben wir schon länger nicht mehr gesehen. In Schrittgeschwindigkeit kämpfen wir uns über schmale Feldwege, die unseren Miet-SUV immer wieder an seine Grenzen bringen, durch das Inland und brauchen für die kurze Strecke letztendlich fast zwei Stunden. Noch schlimmer wird es als die vermeintliche Attraktion, zu der wir fahren sich als geschlossen entpuppt – das blubbernde Matschbecken liegt einsam und verlassen in der Pampa. Um unsere Nerven wieder etwas zu besänftigen, ist unser nächster Halt ein Restaurant, in dem wir lecker Essen gehen, bevor wir das letzte Ausflugsziel des Tages ansteuern: Ein unter Naturschutz stehendes Sumpfgebiet. Mit Kanus fahren wir zwischen den Mangroven entlang zu einer kleinen Insel, auf welcher sich zu Sonnenuntergang hunderte knallrote „Scharlachsichler“ – Trinidads Nationalvögel – einnisten.
Mittwoch 23.04.2025 – Rodizio
Nach den vollen letzten zwei Tagen gingen wir den heutigen Tag ruhiger an: Ausschlafen, gemütlich Frühstücken, Tennis spielen. Zwar kann keiner von uns so wirklich Tennis spielen, doch der Tennisplatz war in der Unterkunft inklusive und so versuchen wir zumindest uns – der brütend heißen Sonne zum Trotz – ein paar Bälle zuzuspielen. Den Nachmittag verbringen wir in einer der zahlreichen Shopping-Malls von Port of Spain. Für das Abendessen hatten wir anschließend einen Tisch in einem Rodizio-Restaurant reserviert. Bei dem brasilianischen Steakhouse-Konzept kommen die Kellner immer wieder mit Fleischspießen verschiedenster Sorten an den Tisch – man probiert sich durch und isst bis man nicht mehr kann. Die Beilagen, die ebenfalls in Form eines großzügigen All-you-can-eat-Buffets zu Verfügung stehen, geraten fast in Vergessenheit, so viel Fleisch landet immer wieder auf meinem Teller. Doch irgendwann passt selbst das leckerste Essen nicht mehr rein – pappsatt machen wir uns auf den Weg nach Hause.
Donnerstag 24.04.2025 – Angel de Orinoco
Viel zu früh klingelt der Wecker. Ein letztes Mal lasse ich das warme Wasser der Dusche über mich prasseln – wer weiß schon, wann es die nächste gäbe. Dann packe ich meinen Rucksack und setze mich zu meiner Familie an den Frühstückstisch. Heute wäre es so weit – ich würde nach Venezuela reisen. In sämtlichen Zeitungsschlagzeilen wird Venezuela der Titel des „gefährlichsten“ Landes der Welt verliehen. Das geht zurück auf den Numbeo-Kriminalitäts-Index, welchen Venezuela anführt. Was Spiegel, Bild und Deutsche Welle allerdings verschweigen ist, dass in dem Index nur 147 der 195 UN-Staaten aufgeführt sind – wirklich „gefährliche“ Länder wie Afghanistan, der Irak, Syrien oder der Sudan fehlen. Mit dem Mietwagen fahren wir von Port of Spain nach Cedros, einem kleinen Ort am nordwestlichsten Zipfel von Trinidad. Drei Stunden dauert die Fahrt, strömender Regen prasselt auf die schlaglochverzierten Straßen. Ein kleines Zelt, dass neben einem Betonpier am Ufer steht, entpuppt sich als das „Fährterminal“, auf Plastikstühlen sitzend warten dort bereits einige Dutzend Locals. Zwar hatte ich gerade wieder genug Geld zusammengespart, um die 250 US-Dollar teure Fähre aus eigener Tasche zu finanzieren, dennoch bestand mein Vater darauf mir das Fährticket zu bezahlen – „Wenn wir dich nicht besuchen gekommen wären, hättest du schließlich mit den anderen auf das Containerschiff gekonnt!“. Es folgen ein paar bürokratische Probleme: Für meine Einreise nach Venezuela muss Ich ein Rückflugticket vorweisen – ohne das könne mich die Fähre nicht mitnehmen. Schnell lade Ich mir aus dem Internet also noch ein gefaketes Flugticket herunter – zurückzufliegen war schließlich nicht mein Plan. Nachdem alles in trockenen Tüchern ist, muss ich mich dann von meiner Familie verschieden – sie würden morgen Abend nach Hause zurückfliegen. Etwas wehmütig gucke ich zu wie die Rücklichter des Mietwagens in der Ferne verschwinden und lasse mich dann auf einem noch freien Plastikstuhl in dem provisorischen Terminal nieder. Vier Stunden vergehen, ohne dass irgendetwas vorwärtsgeht. Währenddessen freunde Ich mich mit einem Mann aus Trinidad an, der neben mir der einzige Nicht-Venezolaner auf der Fähre sein wird. Dann taucht die „Angel de Orinocco“ – die Fähre – am Horizont auf. Drei weitere sich in die länge ziehende Stunden vergehen, bis sich auf einmal etwas zu bewegen beginnt: Wir bekommen unsere gestempelten Pässe zurück und stellen uns dann in einer Reihe auf – das Gepäck wird durchsucht. Schnell entsorge ich noch mein Pfefferspray – das könnte ungut kommen –, doch man wirft schlussendlich nur einen kurzen Blick in meinen Rucksack und wünscht mir dann eine gute Reise. Die Fähre ist – obwohl sie recht klein aussieht – sehr annehmlich: Drei 300 PS starke Motoren, kostenloses WLAN sowie Snacks und Getränke. Die Fahrt wie im Flug, dennoch ist es als wir in Tucupita, einem kleinen Ort im Delta des Orinocos, ankommen bereits dunkel. Einer nach dem anderem passieren wir die Einreisekontrolle. Über Beamte in Venezuela hört man nicht viel Gutes – umso mehr überraschen mich meine eigenen Erfahrungen: Die Beamten sind freundlich und die Einreise absolut unproblematisch. Nachdem man verstanden hat, dass ich deutscher Tourist sei und kein Spanisch spreche, winkt man mich ohne weitere Fragen durch. Geschafft! Draußen wartet bereits mein Couchsurfing-Host, Cesar, der mich für die ersten Nächte bei sich aufnehmen würde.
Freitag 25.04.2025 – Tucupita
Bibbernd wache ich auf – die Klimaanlage hatte beste Arbeit geleistet und den garagenähnlichen Raum über Nacht auf Kühlschranktemperatur heruntergekühlt. Als Ich die Tür aufmache kommt mir eine Wand aus schwüler, 30 Grad heißer Luft entgegen. Cesar sei bereits unterwegs, erklärt mir seine Frau, als sie mir zum Frühstück einen „Arepa“, einen käsegefüllten Teigfladen aus Maismehl, macht – Er käme im Laufe des Vormittags zurück und könne mir dann die Stadt zeigen. Ich warte so lange auf einer Hängematte im Innenhof und gucke die neuste „The Race“-Folge. Wirklich viel zu bieten hat Tucupita aus touristischer Sicht nicht und so fährt Cesar mit mir einfach kreuz und quer durch Dorf. Hin und wieder halten wir an einer Tankstelle – mein Host hatte es sich zur Aufgabe gemacht, dass ich noch heute Cesar alle lokalen Biersorten kennenlerne – Prost! Die OKF scheint kein Ende zu nehmen – als wir um 16:00 Uhr und nach sechs Dosen Bier wieder bei Cesar zuhause angekommen, bin ich froh mich in mein kühles Zimmer verziehen zu können und in Ruhe auszunüchtern.
Samstag 26.04.2025 – Der Griff nach dem Pferdeschwanz
Noch vor Sonnenaufgang verabschiede ich mich von Cesar und laufe zu dem kleinen, aber feinen Busterminal. Der einzige Bus aus Tucupita weg fährt um sechs Uhr und ich will rechtzeitig da sein, denn das Ticket dafür hätte man theoretisch einen Tag im Voraus – also gestern – kaufen müssen. Am Schalter wird mir das zum Verhängnis: Der Bus ist ausverkauft – und der nächste fährt erst am Montag. Zwei Polizeibeamte, die ich um Rat bitte verfrachten mich – nachdem sie provisorisch meinen Rucksack durchsucht und meinen Pass kontrolliert haben – stattdessen in ein Sammeltaxi. Zwei Stunden Autofahrt später – es ist erst kurz vor acht Uhr – überquert das Sammeltaxi die Brücke über den Orinoco und erreicht damit Puerto Ordaz, die zweitgrößte Stadt Venezuelas. Am Busbahnhof ringen sich direkt, die nächsten „Fixer“ um mich – doch erstmal will ich noch gar nicht weiter, sondern in die Stadt. Große Shoppingmalls, moderne Gebäude – Puerto Ordaz ist eine Großstadt wie jede andere. Aufgrund der frühen Uhrzeit haben die meisten Geschäfte noch geschlossen. An einem Straßenstand hole ich mir zum Frühstück ein paar Empanadas und laufe dann zu einem Supermarkt. Zahlen tue ich hier im Supermarkt und auch überall sonst mit US-Dollar, die hierzulande das gängigste Zahlungsmittel sind. Die lokale Währung – der venezolanische Bolivar – hatte allein letztes Jahr eine Inflationsrate von 338% (auf 50 Jahre gerechnet sind es sage und schreibe 344509%) und damit die zweithöchste weltweit – selbst Monopoly-Scheine sind mehr wert. Dennoch bekomme ich mein Wechselgeld – ein paar Cent – in Form von sieben venezolanischen Banknoten. Zurück am Busbahnhof finde ich innerhalb von Sekunden einen preiswerten Bus nach Upata, der nächsten größeren Stadt. Der Bus ist ranzig, überall liegt Dreck, es riecht nach Urin. Ich hatte weder ein Ticket bekommen, noch war der „Fixer“, bei dem ich die Fahrt bezahlt hatte mit in den Bus gestiegen – so beschließe ich das, falls der Bus weiter als Upata fahren sollte, ich einfach sitzen bleiben würde. Zu meiner Enttäuschung ist dann aber doch schon in Upata Endstation. Von Upata aus führt nur noch eine lange Straße weiter in den Norden zur brasilianischen Grenze – perfekte Bedingungen zum Trampen. Dass das Auswärtige Amt – genau so wie meine Mutter – vom Trampen in Venezuela abriet, muss ich wohl kaum erwähnen, doch meine Neugierde überwiegt. Eine kostenlose Mitfahrgelegenheit wird in Venezuela als „cola“ bezeichnet, was zugleich das Wort für „Pferdeschwanz“ ist. Der ungewöhnliche Sprachgebrauch geht auf die Zeit zurück, zu der man noch mit Kutschen unterwegs war – irgendwie cool. Am Ortsausgang gibt es einen Polizeicheckpoint, dort laufe ich hin und frage die Beamten, ob sie mir einen „cola“ gen Norden organisieren könnten. Von Checkpoint zu Checkpoint zu trampen, war – so wurde mir gesagt – der einfachste Weg, um in Venezuela günstig von A nach B zu kommen. Keine zehn Minuten dauert es, bis ich in einem bunten Bus mit lauter Musik einsteige. Als einziger Tourist erwecke ich sofort das Aufsehen der in dem Party-Bus sitzenden Locals, die mir mit einer unglaublichen Herzlichkeit Essen und Getränke reichen. Stundenlang tuckert der Bus mit einem gemächlichen Tempo die Hauptstraße entlang. Der Sitz ist unbequem, meine Ohren kurz davor taub zu werden und doch habe ich ein breites Grinsen auf dem Gesicht – genau wegen solchen Erfahrungen bin ich unterwegs. Als wir für einen kleine Pause am Straßenrand halten, reicht einer der Locals mir etwas schwarzes Kaugummiartiges. Kaum habe ich das Stück in den Mund gesteckt, spucke ich es wieder aus – Pfui! Die Traube um mich herum amüsiert sich und deutet mir an, dass ich davon lieber nichts nehmen sollte. Später erfahre ich das es sich um „Chimó“ – eine tabakhaltige Paste – handelt. Nach einigen weiteren Stunden Fahrt nähert sich der Bus meinem Tagesziel, dem kleinen Ort Tumeremo. Gerade als wir den Checkpoint am Ortseingang erreichen, knallt es auf einmal – unser Bus hatte seinen Auspuff verloren. Ich schnappe mir meinen Rucksack, lasse den Bus zurück und laufe die letzten zwei Kilometer zu Fuß. Auf dem Hinterhof eines kleinen Streetside-Restaurants schlage ich mein Zelt auf und bestelle mir dann etwas zu Essen.
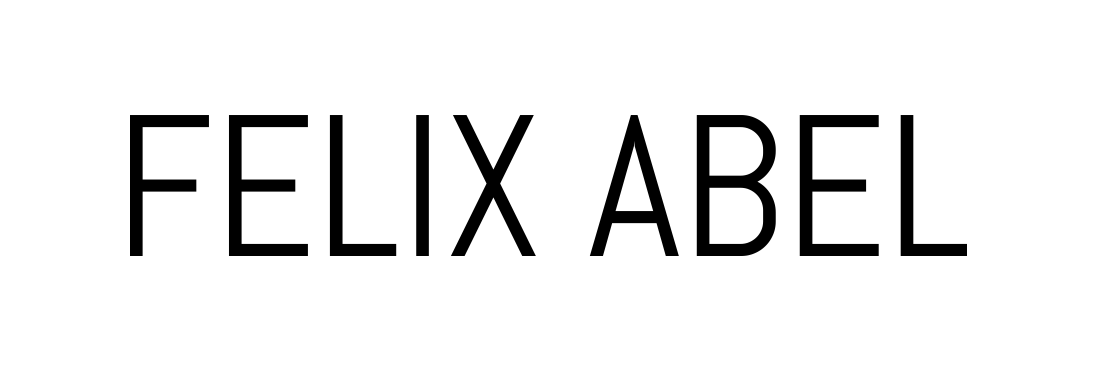

















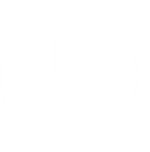


Sonntag 27.04.2025 – Gran Sabana
Durch den Lärm einiger Lastwagen, die den Hof des Restaurants ebenfalls für ihre Nachtruhe genutzt hatten, geweckt, beginnt mein Tag in den frühen Morgenstunden. Wo ich gerade schon auf einem Trucker-Parkplatz stehe, nutze ich zumindest die Chance und frage herum, ob nicht irgendjemand zufällig in meine Richtung fährt. Doch entweder sind die Lastwagen bereits voll oder haben ein anderes Ziel als Ich. Zu Fuß stapfe ich also erstmal in Richtung Zivilisation. Schon nach wenigen Schritten, hält neben mir einer der Laster, mit denen ich vorhin gesprochen hatte. „Wenn du hinten rauf kletterst, können wir dich zumindest mit in die Stadt nehmen!“ Auf einigen Maschendrahtzaun-Rollen auf der Ladefläche thronend bin ich so im Nullkommanichts in Stadtzentrum von Tumeremo. Mein Plan: Ich laufe zum Ortsausgang, freunde mich dort am Polizeicheckpoint mit einem der Beamten an und lass mir eine schöne Langstrecken-Mitfahrgelegenheit organisieren – und was soll ich sagen, der Plan geht sowas von auf: Solidare, einer der Militärpolizisten an dem Checkpoint, sucht ebenfalls nach einem „cola“ in Richtung Brasilien. Keine dreißig Minuten vergehen, bis ich gemeinsam mit ihm in einen klimatisierten Reisebus einsteige, der uns mit gen Norden nimmt. Anfangs ist der Bus noch überfüllt – ich muss in Gang stehen – doch mit der Zeit steigen mehr und mehr Fahrgäste aus und Ich komme in den Genuss eines Sitzplatzes. Stunde um Stunde rollen wir die mal besser, mal schlechter geteerte Fernstraße „Troncal 10“ entlang in Richtung Norden. So bequem und unkompliziert war das Trampen bisher in keinem Land – es fühlt sich fast schon illegal an, so simpel ist es. Als wir nach 170 Kilometern kostenloser Fahrt erreichen wir „Kilómetro 88“ und damit die Endstation des Busses. Es ist erst Mittag. Ursprünglich hatte ich überlegt eine Nacht in dem Goldgräberdorf zu verbringen, doch in Anbetracht des noch jungen Tages wäre das unsinnig – wenn das Trampen weiter so gut liefe, könne ich es noch heute bis nach Santa Elena schaffen. Gemeinsam mit Solidare laufe ich zum nächsten Polizeicheckpoint, wo er seine Kollegen anweist uns den nächsten „cola“ zu organisieren. Die beiden Beamten an dem Checkpoint scheinen nicht sonderlich motiviert, noch dazu fließt kaum Verkehr und so warten wir eine Gefühlte Ewigkeit. Als wir um 16:00 Uhr noch immer auf der Bank vor der Polizeistation sitzen und sich langsam, aber sicher abzeichnet, dass es heute mit Santa Elena nichts mehr werden würde, greife ich auf meinen ursprünglichen Plan zurück: Einige Kilometer außerhalb von Kilómetro 88 soll sich ein Aussichtspunkt mit Blick über die Gran Sabana – ein den Nordosten Venezuelas bedeckendes Naturschutzgebiet aus Regenwald und Steppenlandschaften – befinden and dem ich mein Zelt aufschlagen könne. Doch Solidare will mich nicht gehen lassen: Ich? Allein? in Venezuela? – das wäre viel zu gefährlich. Inzwischen hat es zu dämmern begonnen, Solidare war zu einem Geschäft gelaufen, um etwas zu Essen zu organisieren, die Beamten am Checkpoint waren von der nächsten Schicht abgelöst worden. Plötzlich ruft mich jemand: „Komm, steig ein, die fahren nach Santa Elena!“ – gerade einmal fünf Minuten im Dienst, hatte mir der neue Beamte einen „cola“ klargemacht. Wow! Schnell verstaue ich meinen Rucksack in dem kleinen Kombi, dessen Zustand mich an afrikanische Autos erinnert. Die Rückbank fehlt – ein Stück Pappkarton dient mir als Polsterung auf der blanken Karosserie. Die Fahrer, zwei freundliche Männer mittleren Alters, erzählen, dass sie Teil der indigenen Bevölkerung seien. Nach nur zehn Minuten Fahrt halten wir an einem Restaurant am Straßenrand, wo man mich zum Essen einlädt, bevor wir dann auf mal mehr, mal weniger guten Straßen durch die pechschwarze Nacht düsen. Um kurz vor Mitternacht erreichen wir Kumarakapay, einen Ort 60 Kilometer vor Santa Elena, wo die beiden wohnen – hier wäre heute Endstation. Unter einem mit Stroh gedeckten Unterstand darf ich meine Hängematte aufhängen und schlafe schnell ein.